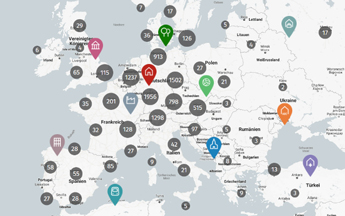Museum Voorlinden in Wassenaar
Metalldach mit abgewinkelten Röhren führt Tageslicht in die Ausstellungsräume
Nahe der Nordseeküste bei Den Haag dienen die Ausstellungsräume des Museum Voorlinden in Wassenaar vor allem dazu, das landschaftsspezifische Licht einzufangen. Und damit eine der größten Kunstsammlungen der Niederlande, die sogenannte Caldic Collectie des Industriellen und Bauherrn Joop van Caldenborgh, bestmöglich zu präsentieren. Kraaijvanger Architekten aus Rotterdam entwarfen dafür einen lang gestreckten, eingeschossigen Museumsbau, dessen tragende und raumbildende Struktur aus sechs parallel angeordneten Wänden besteht. Ihre Außenseiten sind, entsprechend dem Farbton der Dünen, mit sandfarbenem Naturstein bekleidet. Sie verhindern direktes Licht von der Seite, zudem schaffen sie Blickbeziehungen in die umgebende Parklandschaft des van Caldenborgh'schen Anwesens.
Gallerie
Das berühmte „Dutch Light“ – Inspiration zahlreicher niederländischer Künstler während der vergangenen Jahrhunderte – dringt durch großflächige Verglasungen im Nordosten und Südwesten, vor allem aber durch die allseitig auskragende, ungewöhnlich leicht wirkende Metalldachkonstruktion in das Gebäude.
Das Museum ist dreigeteilt in Bereiche für die
Sammlungspräsentation, Wechselausstellungen sowie Installationen,
die speziell für diesen Kunst-Ort entwickelt wurden. Sein Eingang
befindet sich an der südöstlichen Längsseite, und auch die übrigen
Nutzungen wie ein Auditorium, eine Bibliothek, eine
Restaurationswerkstatt, Veranstaltungsräume und der Museumsshop
flankieren die Kernfunktionen. Bauingenieure, Architekten und
Fachplaner entwickelten das Ausstellungshaus gemeinsam, das als
separate Konstruktion unter einem Stahldach dem Prinzip der Neuen
Nationalgalerie Mies van der Rohes in Berlin ähnelt. Durch die
Trennung von Dachkonstruktion und Museumsräumen konnten sämtliche
Elemente filigraner und transparenter ausgeführt werden. Auch der
Flexibilität des Grundrisses kommt die Konstruktionsweise zugute,
da die nicht tragenden Innenwände variabel sind, und sich
Ausstellungen immer neu arrangieren lassen.
Flachdach
Das Flachdach ist eine Konstruktion aus zwei, zum Teil auch drei
Ebenen (siehe Abb. 9). Die oberste aus Stahl und Aluminium scheint
über den Austellungsräumen zu schweben. Sie dient nicht als
Wetterschutz, sondern ist mit 115.000 abgewinkelt geschnittenen,
kurzen Röhren versehen, die indirektes Tageslicht gleichmäßig nach
unten führen. Diese Dachebene ist mit Haupt- und Nebenträgern
konstruiert, welche ihre Last auf eingespannte Stützen übertragen,
die entweder in den Wandscheiben eingebunden oder freistehend sind
und das Gebäude umlaufend als moderne Kolonnaden fassen – als sehr
schlanke und hohe, weiße Doppelstützen.
Als zweite Ebene folgt die gläserne Dachhaut im Gefälle auf einer Stahlkonstruktion, die auf den gemauerten Wänden lastet. Die dritte und unterste Ebene ist eine abgehängte Decke, die je nach Anforderung variiert: Mal lassen transluzente Platten das indirekte Licht von oben in den Raum fließen, an anderer Stelle sind massive Platten mit Lichtspots (LEDs) für eine gezielte Beleuchtung versehen. Gewünscht ist laut Architekten ein „fast magisches Licht“ zu jeder Jahres- und Tageszeit – andererseits sollen die Variationen der Lichtintensität und -farbe jeden Besuch einzigartig machen. Der klare Kontrast der massiven Wandscheiben zu den riesigen Glasflächen und einer fast luftig wirkenden Stahlkonstruktion verleiht dem Museum inmitten der Parklandschaft seinen besonderen Reiz.
Bautafel
Architekt: Kraaijvanger Architects, Rotterdam
Projektbeteiligte: Caldic Collectie, Rotterdam (Baumanagement); Pieters Bouwtechniek, Amsterdam (Tragwerksplanung); Arup, Amsterdam (Technische Gebäudeausrüstung)
Bauherr: Joop van Caldenborgh, Wassenaar
Fertigstellung: 2016
Standort: Buurtweg 90, 2244 Wassenaar, Niederlande
Bildnachweis: Ronald Tilleman, Rotterdam
Fachwissen zum Thema
Paul Bauder GmbH & Co. KG | Korntaler Landstraße 63 | 70499 Stuttgart | www.bauder.de