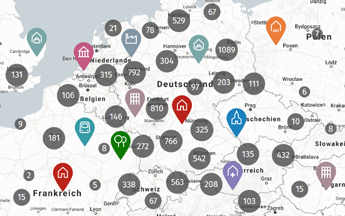Verwaltungssitz Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen
Ton in Ton
Dass auch ein städtisches Versorgungsunternehmen die eigene Außenwirkung gut zu kuratieren weiß, beweist die neue Verwaltungszentrale der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen. Mit edler Aluminiumfassade und minimalistischer Formensprache wird der durch das Stuttgarter Büro Lima Architekten entworfene Solitär zum Signet des öffentlichen Unternehmens und zeigt durch geschickte Platzierung an der Betriebszufahrt und Vorversetzung aus der Ebene der Bestandsbauten Präsenz im Stadtraum. Erwartungsgemäß ist ein Gebäude, in dem die Energieversorgung einer Stadt organisiert wird, ein Paradebeispiel energieeffizienten Bauens. Das ist von außen vor allem am Sonnenschutz erkennbar, der je nach Wetterlage das Fassadenbild beeinflusst, ohne dabei dessen gestalterisches Gleichmaß zu beeinträchtigen.
Gallerie
Gliederung mit eloxierten Aluminiumrahmen
Alle
Verwaltungsbereiche der Stadtwerke, die zuvor in verschiedenen
Bestandsbauten auf dem Bauhof am Standort Benz- und Maybachstraße
verteilt waren, werden im viergeschossigen Neubau mit einer
Bruttogeschossfläche von 1.850 Quadratmetern im nördlichen Teil des
Grundstücks zusammengeführt. Der Sockel des kubischen Baukörpers
ist als Stahlbetonmassivbau ausgeführt. Die Bürogeschosse darüber
wurden in Stahlbetonskelettbauweise mit schlanken Betonstützen und
Flachdecken errichtet.
Die geschlossenen Wandbereiche der Erdgeschossfassade sind mit vorgehängten Betonfertigteilen verkleidet, um die Charakteristik des massiven Sockels nach außen abzubilden. Die Gliederung der Obergeschosse erfolgt durch eloxierte Aluminiumrahmen, die der Fassade eine plastische Tiefe verleihen. Dahinter sitzen im Wechsel vorgehängte eloxierte Aluminiumpaneele und geschosshoch verglaste Flächen. Das Dachgeschoss ist etwas höher als die Regelgeschosse.
Zur Skulptur erhoben
Die Erdgeschossfassade des kubischen Baukörpers ist auf der Westseite zurückversetzt, sodass ein überdachter repräsentativer Eingangsbereich entsteht. Ein weiterer Zugang befindet sich auf der Ostseite und ist den Mitarbeitenden vorbehalten. Die Mieter des dritten Obergeschosses betreten das Gebäude über den Eingang Nord. Die unterschiedlichen Zugänge erlauben Flexibilität, etwa bei einer Umnutzung: Dann können die Geschosse durch das dem Grundriss zugrundeliegende Achsraster und den Einsatz von Systemtrennwänden neu gestaltet und in zwei Einheiten mit separaten Eingängen unterteilt werden.
Das Foyer mit Empfangstresen verfügt über einen Luftraum bis ins erste Obergeschoss und einen offenen Versorgungsschacht, der als Schaukasten Versorgungsleitungen – etwa für Wasser, Strom und Wärme – skulptural inszeniert. Die Installation spielt auf das Metier der Stadtwerke als Versorger an und setzt einen Farbakzent in dem ansonsten durch Beton und Einbauten in Hellgrau geprägten Interieur. Angegliedert befindet sich ein großer Vortragsraum, der auch für Veranstaltungen genutzt wird und durch mobile Wände in das Foyer erweitert werden kann. Ein aussteifender zentraler Versorgungskern nimmt das Treppenhaus, den Fahrstuhl sowie Sanitär- und Technikräume auf. Darum herum gliedern sich die Büros und Besprechungsräume auf den oberen Etagen an.
Im Betrieb kostengünstig
Der kompakte Baukörper erzielt ein gutes Verhältnis von Hüllfläche zu Rauminhalt und wurde mit hochwärmegedämmten Aluminiumpaneelen und Dreifachverglasungen ausgeführt. Die verwendeten Materialien sind hochwertig, wartungsarm und robust und sorgen so für ein langlebiges und im Betrieb kostengünstiges Bauwerk. Die thermische Grundlast für das Heizen und Kühlen wird durch ein regeneratives Heizsystem basierend auf Geothermie bereitgestellt. Die Abwärme des Serverraums wird in das energetische System integriert.
In den Decken befindet sich eine Betonteilaktivierung zur Raumheizung und Kühlung. Alle Büroetagen sind an eine mechanische Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung angeschlossen. Im Erdgeschoss können die Räume über verglaste Öffnungsflügel natürlich belüftet werden, in den Obergeschossen geschieht dies über Öffnungsklappen in den geschlossenen Teilen der Fassade. Photovoltaikelemente auf dem Dach erzeugen Strom für das Gebäude.
Sonnenschutz: Fassadenintegrierte Fenstermarkisen
Teil des effizienten Energiekonzepts ist der außen liegende
textile Sonnenschutz. Die in die vorgehängten eloxierten
Aluminiumrahmen der Fassade integrierten Fenstermarkisen sind durch
die Zip-Technik stabil montiert und halten auch stärkeren
Windlasten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde stand. Sie bieten
individuellen Blendschutz am Arbeitsplatz und verhindern auf
Wunsch, dass direktes Sonnenlicht den Innenraum aufheizt.
Geregelt werden sie über eine zentrale Steuerungseinheit, die
auch über eine smarte Wettersensorik verfügt, oder alternativ von
den einzelnen Räumen aus. Indem die textilen Behänge synchronisiert
herabgelassen werden können, ergibt sich ein äußerst homogenes
Fassadenbild, egal bei welchem Öffnungsgrad. Farblich ist der
Markisenstoff in hellem Grau perfekt auf die Farbe der eloxierten
Aluminiumfassadenelemente sowie den Fertigbeton im Erdgeschoss
abgestimmt. -sr
Bautafel
Architektur: Lima Architekten, Stuttgart
Projektbeteiligte: Weischede, Herrmann und Partner, Stuttgart (Tragwerksplanung); IWP Ingenieurbüro für Systemplanung, Stuttgart (HLS-Planung); GBI Gackstatter Beratende Ingenieure, Erfurt (Elektroplanung); Fritzen 28 Brandschutzingenieure, Esslingen (Brandschutz); EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik, Stuttgart (Bauphysik); Warema, Marktheidenfeld (Sonnenschutz); Kieback & Peter, Berlin (Gebäudeautomation)
Bauherrschaft: Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen
Fertigstellung: 2020
Standort: Benzstraße 24, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Bildnachweis: Brigida González, Stuttgart
Fachwissen zum Thema
Baunetz Wissen Sonnenschutz sponsored by:
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Kontakt: 0711 / 9751-0 | info@mhz.de