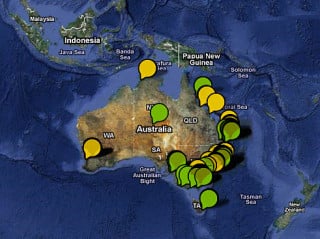Bürogebäude in Melbourne
Nachhaltiger Quader mit historischem Sockel
Beim Berliner Reichstagsgebäude in erhabener Symmetrie, im Neuen Museum der Hauptstadt ganz subtil und bei der Elbphilharmonie in Hamburg mit der ganz großen Geste – gut umgesetzt, entfaltet das Bauen im Bestand enormes städtebauliches Potential. Die Ergänzung historischer Bauwerke mit Umbauten und Erweiterungen aus späteren Epochen ist zudem nachhaltig, denn Bausubstanz und die darin enthaltene graue Energie sowie der für die Gesellschaft baukulturell relevante Wert bleiben erhalten. Dass es sich bei den Hybriden aus Alt und Neu nicht immer gleich um das politische Herz eines Landes oder Kulturpaläste mit Landmarkenstatus handeln muss, zeigt ein gelungenes Projekt in Melbourne. Das ortsansässige Gestaltungsbüro Fieldwork setzte hier einem flachen Fabrikgebäude des frühen 19. Jahrhunderts ganze sieben Geschosse Büroneubau auf das Dach. Spannung im Straßenbild erzeugen dabei nicht nur das Zusammenstoßen der Baustile, sondern auch die Beschaffenheit der neuen Fassadenteile: rechteckige Streckmetallelementen, die sich teilweise öffnen lassen, oder – im geschlossenen Zustand – das Gebäudeinnere vor der Hitze der australischen Sonne schützen.
Gallerie
Aufstockung mit Signalwirkung
Das Fabrikgebäude im frühen edwardianischen Stil liegt am Rande der Stadt auf einem Eckgrundstück. Die Aufstockung soll dynamisch auf die Umgebung reagieren. Von den Architekten als „Buchstütze“ bezeichnet, fungiert der Bau als Eingangsmarker zum Stadtbezirk. Die Rhythmisierung der zeitgenössischen Fassade aus stehenden Rechtecken steht im Kontrast zur Horizontalgliederung des historischen Mauerwerks.
Auch farblich und materiell steht der hoch aufragende
quaderförmige Baukörper aus durchlässigem Metall im starken
Gegensatz zum flachen Sockel aus massivem Mauerwerk. Über den
Sprung in den Zeitschichten besteht damit kein Zweifel. Von der
historisch bedeutsamen Westfassade ist der moderne Aufsatz in einer
respektvollen Geste um einige Meter zurückversetzt. An der Ostseite
befinden sich alte und neue Fassade in einer Flucht. Durch das
Einfügen einer umhüllten Dachterrasse oberhalb des fünften
Obergeschosses wird die nordwestliche Ecke des Gebäudes betont.
Hier schimmert zudem ein Olivenbaum durch die Maschen der
Streckmetallhülle hindurch.
Behutsame Konservierung des Bestands
Die sorgfältig restaurierten Bestandsfassaden stehen beispielhaft für die industrielle Entwicklung von Cremorne im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Ursprüngliche Bauteile wie Türen, Holzfenster, Kugelaufsätze und der historische Kalkputz wurden wiederhergestellt oder nachgearbeitet. Ein Teil des vorhandenen verzinkten Stahldaches zwischen Attika und Neubau wurde renoviert, um die ursprüngliche Dachlinie anzuzeigen.
Die einfachere Nordfassade war in ihrer Struktur nicht mehr tragfähig. Sie wurde behutsam abgetragen und mit originalen Ziegeln und historischen Stahlfenstern wiedererrichtet. Um zwischen dem originalen und dem erneuerten Mauerwerk unterscheiden zu können, wurde für Letzteres ein roter Mörtel verwendet. Eine vorhandene Fallrohraussparung blieb als Schattenfuge an der Verbindungsstelle zwischen der historischen West- und der rekonstruierten Nordfassade erhalten. Neue Zugänge wurden an zwei ursprünglichen Fensterpositionen erstellt, um den Rhythmus des Straßenbilds beizubehalten.
Sonnenschutz: Klappläden senken den Energiebedarf des Gebäudes
Die Streckmetallgitter bilden die äußere Schicht einer Doppelhautfassade. Die durch die Streckung erzeugte Winkelstellung der einzelnen Metallbahnen schirmt im Sommer die höher stehende Sonne ab und reduziert somit den solaren Wärmeeintrag. Zugleich verfügen die Gitter über einen Öffnungsgrad, der groß genug ist, um die tief stehende Wintersonne einfallen zu lassen. Auch bei geschlossenen Läden sind gefilterte Ausblicke möglich. Um diese jedoch auch ungehindert zu ermöglichen, können die Paneele geöffnet werden. Jedes einzelne ist mit einem elektrischen Stellmotor ausgestattet, der es den Gebäudenutzern erlaubt, den Öffnungsgrad der Fassade nach eigenen Wünschen einzustellen. Durch einen Wettersensor kann die manuelle Bedienung übersteuert werden. Bei zu hohen Temperaturen und Windstärken schließen die Klappläden automatisch.
Außen erzeugt die individuelle Öffnungsoption ein abwechslungsreiches Fassadenbild, das mit dem monolithischen Eindruck bricht, der sich einstellt, wenn alle Klappläden geschlossen sind. Photovoltaikmodule liefern die zum Betrieb der Fassade nötige elektrische Energie. Hinter dem metallischen Sonnenschutz verbirgt sich eine thermische Gebäudehülle aus bodentiefen Verglasungen, die in schmalen Aluminiumrahmen sitzen. Klappfenster unterhalb der Decke ermöglichen eine natürliche Belüftung.
Neben der anpassungsfähigen Sonnenschutzfassade und der
Photovoltaikanlage wurden mit dem Bau zahlreiche weitere Aspekte
eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzeptes umgesetzt, sodass das
Projekt mit fünf von sechs Sternen des australischen
Nachhaltigkeitszertifikats Green Star ausgezeichnet wurde.
-sr
Bautafel
Architektur: Fieldwork, Melbourne
Projektbeteiligte: Cobilt, Melbourne (Projektmanagement, Bauherrschaft); GIW, Melbourne (Umweltberatung); Adams Consulting Engineers, Melbourne (Tragwerksplanung); NJM Design Consulting Engineers, Melbourne (Versorgungstechnik); Tract Consultants, Melbourne (Landschaftsarchitektur); Tensys, Melbourne (Fassade); Locker Group, Melbourne (Sonnenschutz)
Bauherr: Cobilt, Melbourne
Standort: 9 Cremorne Street, Cremorne VIC 3121, Australien
Fertigstellung: 2020
Bildnachweis: Peter Clarke, Melbourne
Fachwissen zum Thema
Baunetz Wissen Sonnenschutz sponsored by:
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Kontakt: 0711 / 9751-0 | info@mhz.de