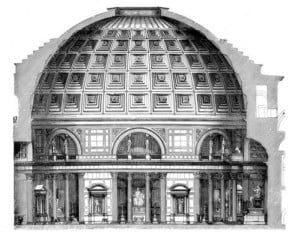Korkenzieherhaus in Berlin-Staaken
Oben Kork, unten Stampfbeton
Ungewöhnliche Materialien wählte das Architekturbüro Rundzwei Architekten für ein Wohnhaus in Berlin-Staaken: Fassadenplatten aus Kork umhüllen den Bau und im Untergeschoss verkleidet eine Vorsatzschale aus Stampfbeton den Rohbau. Das Fassadenmaterial stammt aus Portugal, wo Korkgranulat – ein Abfallprodukt der dortigen Flaschenkorkproduktion – zu Platten verarbeitet wird. Laut Architekten sind diese, dank des enthaltenen Harzes, ohne Zusätze und Chemikalien auf natürliche Weise gegen Witterung und Schimmel resistent. Zudem tragen sie, aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit, auch zur Dämmung des Hauses bei.
Gallerie
Innere Organisation
Die Architekten unterschieden bei der Konstruktion klar zwischen Bereichen, die unter dem Geländeniveau liegen, und oberirdischen Gebäudeteilen: Über dem Untergeschoss aus Beton sitzt eine Holzkonstruktion auf quadratischem Grundriss. Planungsrechtlich war auf dem Grundstück nur ein Vollgeschoss erlaubt. Um für die drei Bewohner trotzdem ausreichend Raum zu schaffen, verlegten die Architekten die Wohnräume teilweise ins Untergeschoss und wählten ein Kreuzdach. Zudem bedienten sie sich des Split-Level-Prinzips, um eine geschickte Ausnutzung des Volumens zu erreichen. Die spiralförmig angelegten Ebenen führten, in Kombination mit der Fassade, zur Bezeichnung Korkenzieherhaus. Eine vierläufige Treppe im Zentrum verbindet die unterschiedlichen Geschosse. Verglaste Dachflächen sorgen für Tageslicht im Erschließungsbereich.
Von der Eingangszone im Erdgeschoss, der ein Gästezimmer und -bad zugeordnet sind, gelangt man in den weitgehend verglasten Wohn- und Essbereich, der zur Küche hin offen gestaltet ist. Die Privaträume der Bauherrin, zu denen eine Sauna, ein Schlafzimmer, ein Bad und ein Ankleideraum gehören, liegen im Untergeschoss. Ein auf das entsprechende Niveau abgesenkter Pool erweitert die Räume optisch in den Außenraum. Dieser Eindruck wird durch die Materialität der Stampfbetonwand verstärkt, die innen und außen gleich ist.
Das Obergeschoss ist in zwei Wohnbereiche mit gemeinsamem Wohn- und Esszimmer aufgeteilt. Bei Bedarf lassen sich diese später auch separat erschließen. Ganz oben unter dem Dach ist auf zwei Ebenen ein Rückzugsort zum Arbeiten oder Entspannen entstanden. Die Architekten verzichteten beim Bau des Korkenzieherhauses auf Kleber und Bauschäume. Neben den dämmenden Korkplatten ließen sie Holzfaser- und Zellulose-Dämmstoffe verwenden. Solarpaneele auf dem Dach tragen über ein Schichtenspeichersystem wesentlich zur Wärmeversorgung des Hauses bei.
Beton: Souterrain mit Stampfbeton
Ein Untergeschoss, das wie ausgegraben wirken sollte, und ein Obergeschoss, das über dem weitgehend verglasten Erdgeschoss zu schweben scheint: Das waren die konzeptuellen Ausgangspunkte für den Entwurf. Der Rohbau der unterirdischen und ebenerdigen Bauteile wurde in wasserundurchlässigem Beton ausgeführt, der vor Ort gegossen wurde.
Die Bodenplatten aus Beton sind mit einer Bauteilaktivierung ausgestattet. Ihre Oberflächen wurden flügelgeglättet. Im Souterrain wurden die Wände mit einer Vorsatzschale aus Stampfbeton bekleidet, um die gewünschte archaische Wirkung zu erzielen. Die ursprüngliche Idee, hier Stampflehm zu verwenden, wurde verworfen, weil das Material den Wetter- und Klimaeinflüssen im Außenraum nicht gewachsen wäre. Die Einfriedung des Pools sollte aber unbedingt als Fortsetzung der Wände des Sockelgeschosses gelesen werden können.
Die genaue Rezeptur des Stampfbetons ist nicht überliefert. Es gab im Vorfeld der Bauarbeiten zahlreiche Tests, um die richtige Körnigkeit und Schichtung zu erreichen. Ziel war es, die Oberfläche wie Erdschichten wirken zu lassen – mit dichteren Bereichen und deutlich sichtbaren Kiesnestern. Schließlich entschieden sich die Architekten für eine Körnung mit einem Kleinstkorn von 4 mm und einem Größtkorn von 12 mm. Die Mischung von Zement und Wasser hatte beim Einbau eine erdfeuchte Konsistenz. Durch Beimischen von Kalk wurde der Beton etwas aufgehellt, damit er mit dem Farbton der flügelgeglätteten Böden harmoniert.
Die Schichthöhe bei der Betonage betrug 17 cm – ein Grundmaß,
welches das gesamte Haus prägt: Die Höhen der Split-Level-Ebenen
sind ein Vielfaches dieses Wertes und für die Schalung
wurden 17 cm hohe Bretter verwendet. Bei letzteren wurde darauf
geachtet, dass sich ihre Maserung nicht zu stark auf dem Beton
abzeichnet. Die Schalungskonstruktion musste etwas unkonventionell
abgefangen werden, weil der Boden bereits fertig war und nichts
darin verankert werden konnte. Bei der Betonage legten die
Architekten wert darauf, dass der Übergang zwischen den einzelnen
Stampfbetonschichten nicht gerade verläuft, sondern als leichte
Welle. Verdichtet wurde mit einem selbst gebauten Holzstampfer.
-chi
Bautafel
Architekten: Rundzwei Architekten, Berlin (Team: Marc Dufour-Feronce, Andreas Reeg, Luca Di Carlo, Ana Domenti)
Projektbeteiligte: Ingenieurbüro Krawitz, Berlin (Tragwerksplanung); Energieberater Land Brandenburg, Brandenburg (KfW-Energieberatung); Andreas Zill, Berlin (Bodengutachten); EFG Sandler, Kaufbeuren (Anlagentechnik); Caerus Construction, Berlin (Stampfbeton); Zimmerei Johannsen, Schönwalde-Glien (Holzbau / Korkfassade); Amorim Islamentos, Mozelos (Korkfassade); Cronoflex (Holzfasserdämmung); Seeigel Pooltechnik, Berlin (Pool)
Bauherr: Privat
Standort: Berlin-Staaken
Fertigstellung: 2018
Bildnachweis: Gui Rebelo, Berlin / Rundzwei Architekten, Berlin
Baunetz Architekt*innen
Fachwissen zum Thema
Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das
InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org