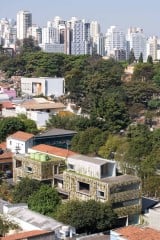Studierendenwohnheim mit Parken in Paris-Saclay
Überzeugende Übergangslösung
Ein Gebäude als ein Regal, das sich mit Nutzungen füllen lässt: Das Wohnheim Rosalind Franklin mit integrierten Parkdecks wuchs aus dieser Idee. Entworfen und geplant wurde der U-förmige Campusbaustein in Paris-Saclay vom Architekturbüro Bruther aus Paris in Kooperation mit dem Brüsseler Atelier Baukunst.
Gallerie
Rund zwanzig Kilometer südwestlich der französischen Hauptstadt entsteht seit 2008 eines der größten Forschungs- und Wissenschaftszentren weltweit. Neben einer neuen Universität und mehreren Hochschulen siedelt sich hier auch die Wirtschaft mit ihren Forschungseinrichtungen an. Das Wohn- und Parkhaus gehört zum Campus Palaiseau, auf dem unter anderem die École Polytechnique und Einrichtungen der französischen Elektrizitätsgesellschaft EDF untergebracht sind (s. auch Bauwerke zum Thema).
Parken auf Zeit
Im Kontext des unfertigen Städtebaus des Forschungscampus bietet das flexible Gebäude Chancen zur Anpassung und Weiterentwicklung. So ist der Bahnhof, der den Campus an das Pariser Stadtzentrum anschließen wird, noch nicht fertiggestellt. Man geht davon aus, dass der Bedarf an Parkplätzen mit einer guten ÖPNV-Anbindung rapide abnehmen wird – daher war eine bauliche Struktur gefragt, bei dem sich die oberirdischen Parketagen bei Bedarf in Wohn- oder Bürogeschosse verwandeln lassen.
Rhythmische Schichtung statt Konglomerat
Das Gebäude gliedert sich im Moment in ein hohes Erdgeschoss, zwei Parketagen, drei Vollgeschosse für studentisches Wohnen und ein Staffelgeschoss mit Tonnendach, in dem der obere Teil der als Maisonettes gestalteten WG-Wohnungen zu finden ist. Obwohl das Bauwerk eher als Studierendenwohnheim mit Parkdecks erscheint denn als Parkgarage mit aufgesetzten Wohnungen, ist es doch das Auto, das das dem Gebäude zugrundeliegende Raster bestimmt: Ein Stützenabstand von 7,60 Meter erlaubt es, drei Fahrzeuge nebeneinander zu parken.
Ausgebautes Gerüst
Die Konstruktion bleibt von außen – wo immer möglich – ablesbar. Das Erdgeschoss ist teilweise offen, umhüllte Bereiche sind unter der Geschossdecke zurückversetzt und wirken wie eingeschobene Boxen. Neben Läden und Bereichen für die Verwaltung sind dort gemeinschaftliche Einrichtungen des Studierendenwohnheims untergebracht. In den Zwischenzonen finden sich unter anderem Fahrradstellplätze und Briefkästen, aber auch zwei skulpturale Rampen, die die Autos als Doppelhelix zu den Parkgeschossen und wieder hinunter führen.
Über den offenen und lediglich mit einer Absturzsicherung aus strukturiertem Acrylglas begrenzten Parketagen folgen die Wohngeschosse mit den 192 Apartments für Studierende. Diese sitzen leicht zurückversetzt in der Konstruktion. Bandfassaden betonen die horizontale Schichtung.
Doppelhelix und Spiralen
In seinen Dimensionen und seiner reduzierten Strenge könnte das alles rigide wirken – wären da nicht die verschlungenen Rampen und die spiralförmigen Außentreppen im gartenähnlichen Innenhof, die stützenfreien Brücken für die Autos, die aufgesetzten Tonnen, verspielte Elemente wie Spiegel und schräg abgehängte Beleuchtung sowie die farbenfrohen Vorhänge, deren Töne als Hommage an Le Corbusier verstanden werden können.
Beton: Glatt und pur
Nicht nur die Farben, auch die
grundsätzliche Konzeption des Gebäudes folgt in Teilen Prinzipien
des großen Meisters. Die von Le Corbusier in „Fünf Punkte zu einer
neuen Architektur“ deklarierten Eigenheiten finden sich alle
wieder: Bauwerk auf Pilotis, freie Grundrissgestaltung, von der
Tragstruktur unabhängige Fassade, Bandfenster und Dachterrassen.
Wie bei den Unités d’Habitation ist es ein Material, das alles
zusammenhält und die Idee inszeniert: Sichtbeton.
In Paris-Saclay ist die Fassade allerdings nicht mit Brettern strukturiert, sondern glatt und großformatig geschalt. Die meisten Bauteile wurden in Ortbeton verwirklicht, bei den spiralförmigen Außentreppen und den Rampen für die Autos kamen jedoch geschwungene Fertigteile zum Einsatz.
Bei den Decken der Parketagen wurde die beschichtete Schalhaut so
gewählt, dass die Oberfläche im Ergebnis das Licht reflektiert –
die beiden Stockwerke werden durch auf die Decke gerichtete
Strahler indirekt ausgeleuchtet. -chi
Bautafel
Architektur: Bruther, Paris, mit Baukunst, Brüssel
Projektbeteiligte: Bmf (Kostenplanung); Batiserf (Tragwerksplanung); VS-A, ingénierie (Fassadenplanung); Gamba (Akustik) ; Franck Neau (Landschaftsplanung); Chevalier Masson (Textildesign) ; Sicra Idf (Generalunternehmen); Rinaldi Structal (Fassadenbau)
Bauherr/in: 1001 Vies & EPA Paris Saclay
Standort: Campus de Palaiseau, Plateau de Saclay, Paris
Fertigstellung: 2020
Bildnachweis: Bruther / © Maxime Delvaux
Fachwissen zum Thema
Bauwerke zum Thema
Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das
InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org