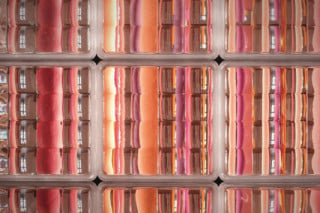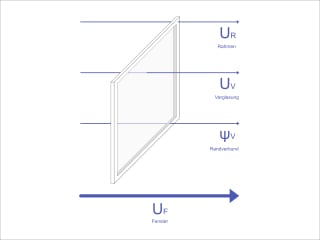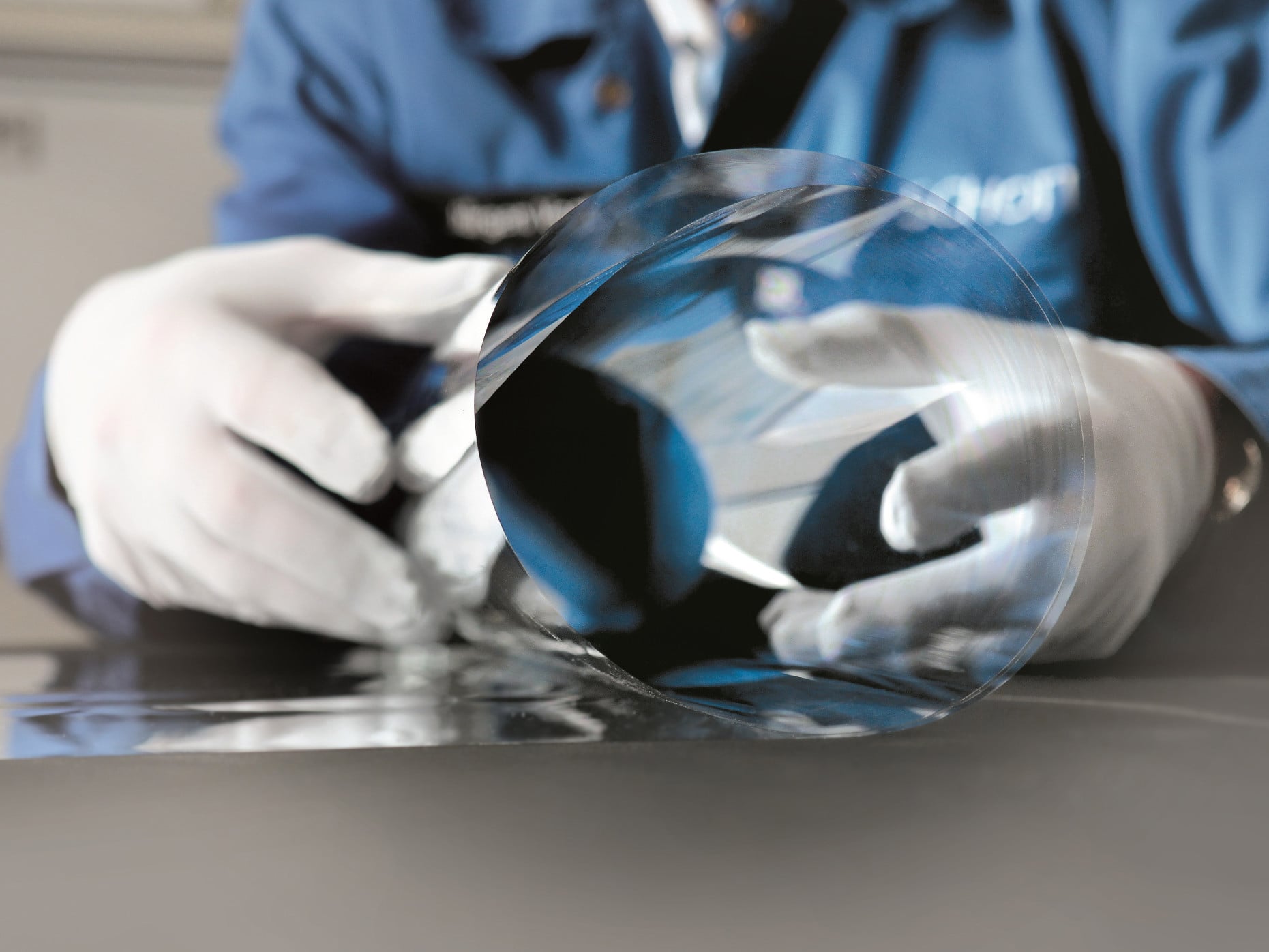Glassteine
Glassteine, umgangssprachlich auch Glasbausteine genannt, bieten die Möglichkeit, semitransparente Wände herzustellen, die den Tageslichtdurchlass nur geringfügig reduzieren. Insbesondere in Gebäuden aus den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts sind sie häufig anzutreffen. Nach DIN 1051 Glas im Bauwesen – Glassteine und Betongläser handelt es sich bei ihnen um Hohlkörper aus zwei Glasschalen, die im Pressverfahren aneinander geschmolzen werden. Glassteine besehen aus Kalk-Natronglas nach DIN EN 572-1 Glas im Bauwesen – Basis-Erzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas, Betonsteine werden aus Zement und Glasschaum hergestellt.
Gallerie
Die Quader gibt es in verschiedenen Größen (meist zwischen 19
und 30 cm Kantenabmessung) mit glatter und durchsichtiger
Oberfläche, ornamentiert oder in der Masse eingefärbt. Die Dicke
der Steine beträgt üblicherweise 8 oder 10 cm. Spezielle
Wärmedämm-, bzw. Brandschutzsteine können auch bis zu 16 cm dick
sein. Üblicherweise werden sie – ähnlich wie Mauerwerk – durch
eine Mörtelschicht miteinander verbunden. Aus Gründen der
Stabilität ist es sinnvoll, bei dieser Art der Verbindung in jeder
zweiten waagerechten und senkrechten Fuge verzinkte Stahl- oder
Edelstahlstäbe einzuarbeiten. Für Echtglasbausteine können auch
Kunststoffprofile und Spezialkleber eingesetzt werden, die für mehr
Halt sorgen. Dadurch erübrigen sich zusätzliche Maßnahmen zur
Stabilität. Acrylglasbausteine lassen sich auch mit einfachen
Stecksystemen nach dem Nut-und-Feder-Prinzip miteinander
verbinden.
Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von bis zu U = 3,5 W/(m²K)
ist die wärmedämmende Wirkung herkömmlicher Glassteine so gering,
dass sie den heutigen bauphysikalischen Anforderungen in der
Verwendung als Außenwand nicht genügen. Mittlerweile gibt es jedoch
auch spezielle Glassteine, die U-Werte zwischen 1,4 und 1,6 W/(m²K)
erreichen. Dagegen verfügen Glassteine über hervorragende statische
und lichtbrechende Eigenschaften, sind außerdem nicht brennbar und
schalldämmend. Dennoch dürfen aus ihnen errichtete Wände keine
Lasten aus dem Bauwerk übernehmen und nicht tragend ausgebildet
sein. Aus diesem Grund finden sie eher in Innenräumen Verwendung.
Aufgrund ihrer pflegeleichten und feuchteunempfindlichen
Oberflächen lassen sie sich auch als Gestaltungselement in Bädern
oder Duschräumen einsetzen. Ihre Bemessung
erfolgt nach DIN 4242 Glasbaustein-Wände; Ausführung und
Bemessung. Anders verhält es sich mit voll oder hohl
ausgebildeten Betongläsern. Sie dürfen für horizontale
Anwendungen wie z.B. Decken verwendet und auch am Lastabtrag
beteiligt sein. Die nach DIN EN 1051 geforderte Druckfestigkeit von
Betongläsern beträgt zwischen 12 kN und 160 kN.
Für Wirkung und Tageslichteinfall sind bei einer Glasbausteinwand
die Beschaffenheit der Steine und ihre Farbe verantwortlich.
Sogenannte Vollsichtsteine gewähren nahezu ungehinderten
Durchblick, während satiniertes Glas nur Licht hindurchlässt, aber
vollständigen Sichtschutz ermöglicht. Sind die Oberflächen gewellt,
entstehen beim Durchsehen leichte optische Verzerrungen. Bei einer
kleinteiligen Profilierung der Glasoberfläche ist trotz des
Tageslichteinfalls eine Durchsicht nicht mehr möglich. Besondere
Raumwirkungen lassen sich durch die Farbgebung von Glasbausteinen
bewirken. Die von den Herstellern angebotene Farbpalette reicht
mittlerweile von Türkis und knalligem Rot bis Schwarz. Je kräftiger
und dunkler die Farbe der Steine ist, desto weniger Licht fällt
allerdings auch hindurch. Die Wechselwirkung zwischen Farbe und
Licht kann ebenso durch gezielt eingesetztes Kunstlicht
beispielsweise durch eine Hinterleuchtung mittels
lichtemittierenden Dioden (LED) erzeugt werden.
Wenn sich an den Oberflächen von Glassteinen Schleier und trübe
Flecken bilden, die nicht aus der unumgänglichen alltäglichen
Verschmutzung durch Staubpartikel der Luft resultieren, handelt es
sich in der Regel um Kalkabscheidungen aus dem Fugenmörtel. In
diesem Fall hilft nur eine Neuverfugung.
Fachwissen zum Thema
Bauwerke zum Thema
BauNetz Wissen Glas sponsored by:
Saint-Gobain Glass Deutschland