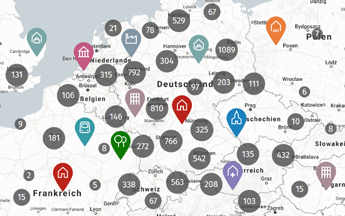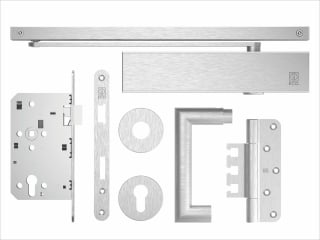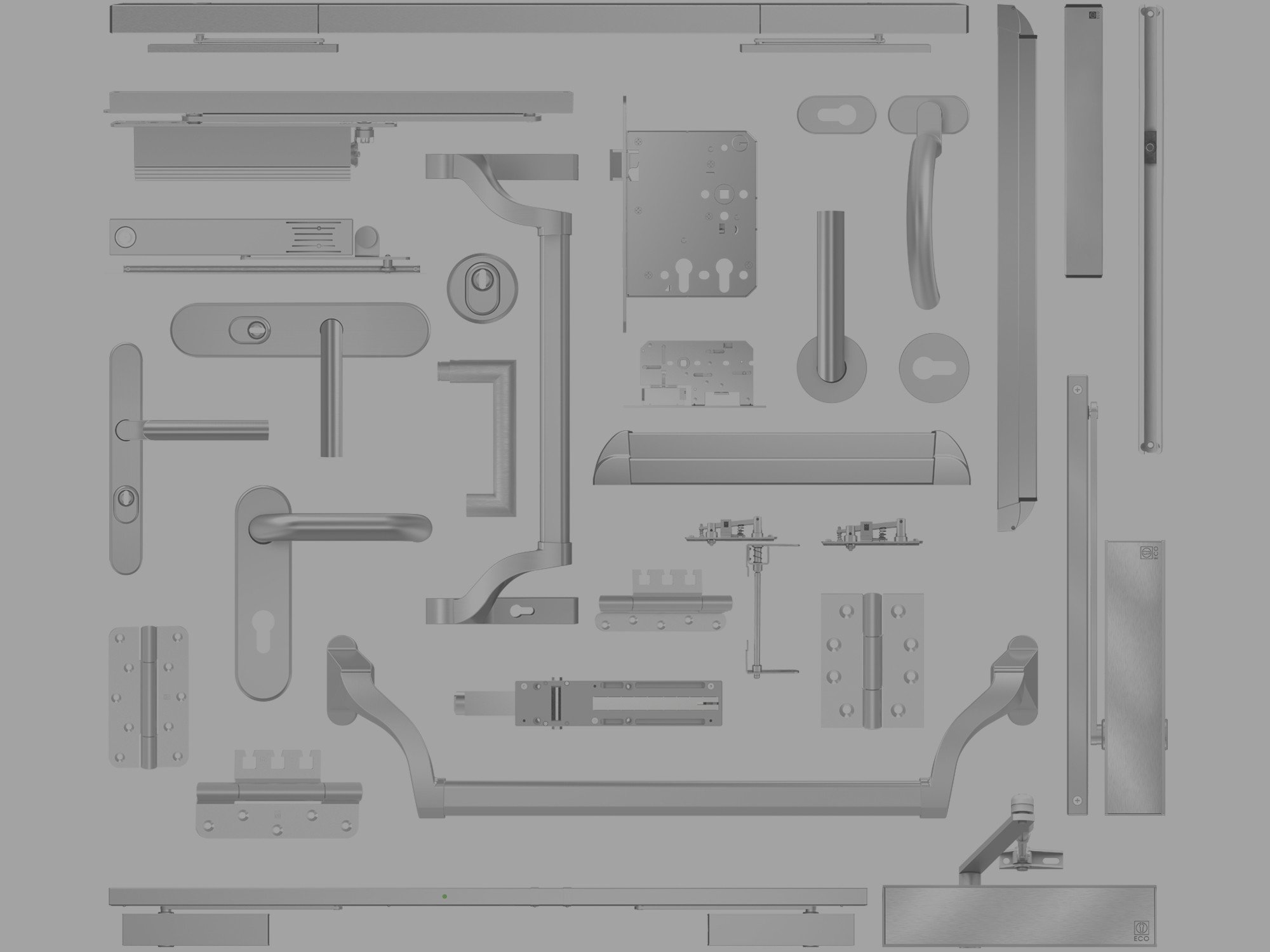Umnutzung eines Lazarettgebäudes in Kiel
Arbeiten und Wohnen im Anscharpark
Der Ausbau der Marine war dem letzten deutschen Kaiser
bekanntermaßen eine Herzensangelegenheit. Mit der Erweiterung des
Kieler Kriegshafens zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand dabei
auch ein Lazarett, das sich, wie viele zeitgleich entstandene
Spitalbauten auch, auf einzelne Pavillons verteilte. Im Stadtteil
Wik zwischen Förde und Kanal in eine Parkanlage gebettet, wurden
die Räumlichkeiten nach dem Weltkrieg durch die
Anschar-Schwesternschaft als ziviles Krankenhaus betrieben, während
andere Teile des Ensembles durch das städtische Hospital sowie das
Universitätsklinikum genutzt wurden. Bauliche Mängel, die der
Nutzung als Heilstätte ein Ende setzten, führten schließlich zum
Abriss etlicher der denkmalgeschützten Pavillons. Zu den Bauten,
die erhalten werden konnten, gehört das einstige
Absonderungsgebäude. Seit einem umfassenden Umbau beherbergt der
Trakt, in dem ursprünglich Patienten mit ansteckenden Krankheiten
untergebracht waren, neben Wohnungen auch das Kieler
Architekturbüro BSP, dem zugleich die Umgestaltung oblag.
Gallerie
Bereits 2003 hatte das Planungsunternehmen ein Konzept zur
denkmalgerechten Nachnutzung des Krankenhausensembles erarbeitet.
Während aber diese Überlegungen weitgehend unberücksichtigt
blieben, verfielen die Pavillons zunehmend. Erst als das Areal zum
Wohnquartier umgestaltet wurde, ergab sich die Gelegenheit, das
Haus mit der Nummer 7, in dem sich zuletzt eine neurochirurgische
Klinik befand, zu retten. Während die steinerne Fassade wie auch
die Treppenhäuser in enger Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden
erhalten und instandgesetzt wurden, bot sich im Innern, das im
Laufe der fast hundertjährigen Nutzungen immer wieder verändert
worden war, die Möglichkeit, zehn zeitgemäße und nutzungsgerechte
Wohneinheiten sowie Büroflächen auf 300 Quadratmetern zu
schaffen.
Tradition und Gegenwart
In der Absicht, die energetische Performance der Fassade zu verbessern, ohne die Anmutung der Gebäudehülle dabei in Mitleidenschaft zu ziehen, wurde der Bau mit einer mineralischen Innendämmung ausgestattet. Indessen sind die Fenster und Außentüren, die in den 1960er-Jahren ausgetauscht worden waren, anhand von Originalelementen der anderen Hospitalbauten rekonstruiert worden. An anderer Stelle wich das Planungsteam hingegen von der ursprünglichen Gestalt ab, sodass etwa Dachaufbauten aus Corten-Stahl an die Stelle der vormaligen Gauben traten. Zugleich galt es neue Lösungen für Herausforderungen zu finden, die sich erst nach Ende der Krankenhausnutzung stellten: So wurde der Altbau nicht nur mit einem Fahrradkeller und einem zusätzlichen Treppenhaus, sondern auch mit Balkonen versehen.
Wohnen und Arbeiten
Das Erdgeschoss des symmetrischen Baus beherbergt im
nordwestlichen Teil das Architekturbüro: Während die Zeichentische
in den einstigen Krankenzimmern zu finden sind, die untereinander
durch Enfiladen verbunden wurden, kann der Krankenhausflur heute
als Besprechungsraum fungieren. Auf der gegenüberliegenden Seite
des Portals, wo im Zuge des Umbaus Wohnungen geschaffen wurden, ist
der Korridor indessen kaum noch zu erahnen, finden sich doch an
Stelle des breiten Gangs nun sogar ein Bad und ein vollwertiges
Zimmer. Dank des neuen Treppenhauses, das ebenfalls hier entstanden
ist, können die Obergeschosse auch ohne lange Flure erschlossen
werden. Wenn sich der Bewohnerschaft somit Räume bieten, die die
frühere Nutzung kaum erahnen lassen, nutzte das Planungskollektiv
gleichwohl die Auseinandersetzung mit dem Bestand, um ungewöhnliche
wie interessante Grundrisse zu schaffen.
Beschläge: Traditionelle Eleganz
Die Herausforderung, die Architektur des Bestandsgebäudes fortzuschreiben, ohne dabei bloß zu rekonstruieren, betraf indessen auch die Details. So fiel etwa die Entscheidung, die historischen Fenstergriffe nicht zu kopieren, sondern unverkennbar zeitgemäße Beschläge zu wählen, die sich gleichwohl durch eine klassische Eleganz auszeichnen. Versehen wurden die Fensterrahmen folglich mit Oliven (die Drehgriffe verdanken ihren Namen der Ähnlichkeit mit der Steinfrucht) aus massivem Edelstahl. Matt gebürstet, harmonieren sie auch durch ihre sichtbare Verschraubung mit der Architektur des einstigen Lazarettgebäudes – und passen ebenso gut zu den gewählten Türdrückern des gleichen Herstellers, die, nicht minder elegant, auf einen Entwurf des dänischen Architekturbüros C. F. Møller zurückgehen. –ar
Bautafel
Architektur: BSP Architekten, Kiel
Projektbeteiligte: Ingenieurbüro für Struktur + Festigkeit, Kiel (Ingenieurplanung); Randi by Eco Schulte, Menden (Fensterolive 1775 und Türdrücker 1060)
Bauherrschaft: Baugemeinschaft Haus 7 im Anscharpark
Fertigstellung: 2017
Standort: Boltenhagener Straße 4-8, 24106 Kiel
Bildnachweis: Bernd Perlbach, Preetz
Fachwissen zum Thema
Bauwerke zum Thema
Surftipps
Baunetz Wissen Beschläge sponsored by:
ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden
Telefon: +49 2373 9276-0
www.eco-schulte.com und www.randi.com