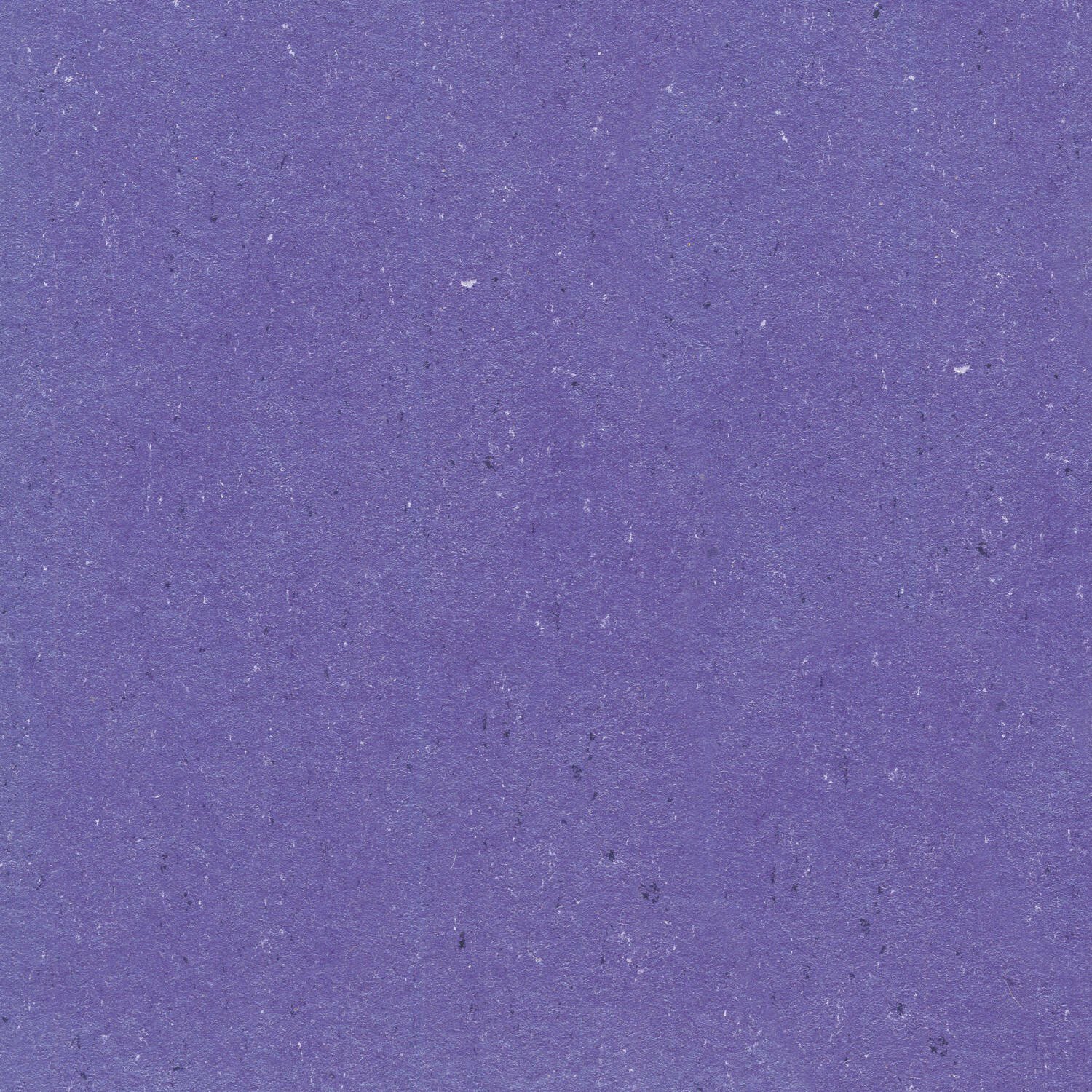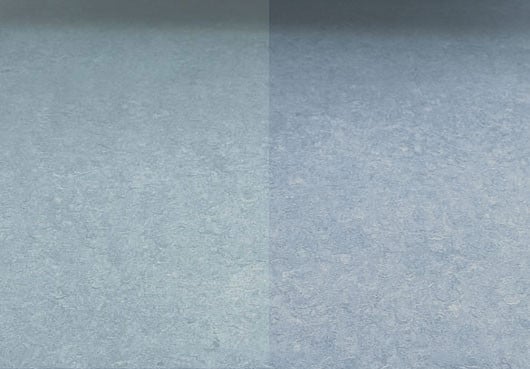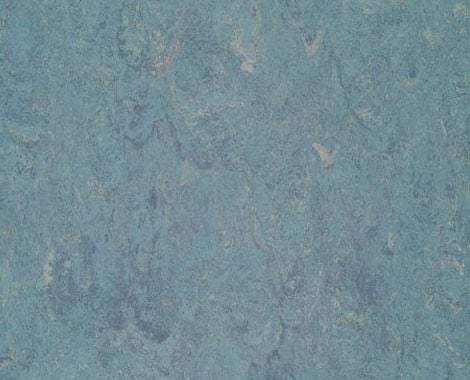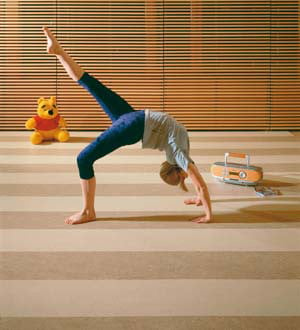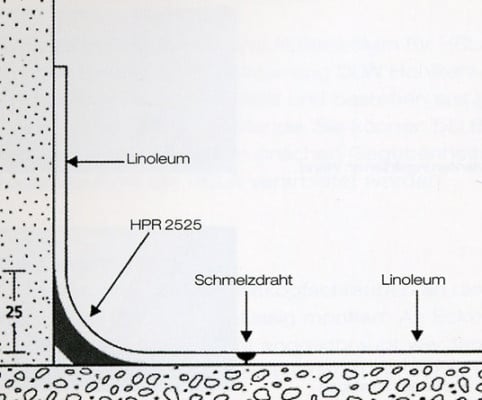Die geschichtliche Entwicklung des Linoleums im 20. Jahrhundert
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde die Ästhetik des künstlerisch gestalteten Linoleums zu einem bedeutsamen Bestandteil der zeitgenössischen Architektur. Besonders die wichtigen Architekten der 20er Jahre – wie Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius – nutzten Linoleum als innenarchitektonisches Gestaltungsmittel.
Gallerie
Den überwältigenden Erfolg dokumentieren die zahlreichen
öffentlichen Ausstellungen, auf denen Linoleum jetzt als
dekorativer Bau- und Werkstoff gefeiert wurde: auf der
Allgemeinen Landes-, Industrie- und Gewerbeausstellung in
Oldenburg 1905 (verbunden mit der Nordwestdeutschen
Kunstausstellung), auf der Ausstellung des Deutschen Museums
für Kunst in Handel und Gewerbe in Dresden 1906 sowie auf den
Weltausstellungen 1910 in Brüssel und 1913 in Genf. Die 1927
errichtete Weißenhofsiedlung in Stuttgart war fast komplett mit
Linoleum ausgestattet, ebenso die Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe
oder die Meisterhäuser von Walter Gropius in Dessau. Als Höhepunkte
der künstlerisch-architektonischen Verwendung von Linoleum gilt die
von Mies van der Rohe und Lilly Reich konzipierte
DLW-Linoleum-Ausstellungseinheit auf der Stuttgarter
Werkbund-Ausstellung Bau und Wohnung aus dem Jahre 1927.
Der Erste Weltkrieg bedeutete eine kurze, aber einschneidende Zäsur
in der Erfolgsgeschichte des Linoleums, da die Einfuhr der
Rohstoffe Jute, Harz und Kork stockte und Leinöl für die Herstellung
von Speisen benötigt wurde. Doch bereits zu Beginn der 20er Jahre
erreichte die deutsche Linoleumproduktion wieder ihr
Vorkriegsvolumen. Während der Weimarer Republik kam es zu einer
starken Konzentration der Linoleum-Industrie in Deutschland: 1926
fusionierten die drei Delmenhorster Linoleum-Fabriken und die
Bietigheimer Fabrik zu den Deutschen Linoleum-Werken.
Unter der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland endete
die Tradition des Künstler-Linoleums abrupt. Als anspruchsloser
Bodenbelag aber war Linoleum vor allem im Objektbau weiterhin
beliebt. Doch gerade hierin gründete sein Niedergang in den 1950er
Jahren: Am Ende der Wirtschaftswunderjahre war Linoleum als
unansehnlicher Bodenbelag für Treppenhäuser und Krankenhausflure
verpönt, der Geruch des Muffigen, Verstaubten, des Unmodernen
hatte sich über den einst geliebten und gefeierten Bodenbelag
gelegt. Seit den 60er Jahren kamen außerdem zahlreiche
Konkurrenzprodukte auf den Markt: moderne Kunststoff-Beläge und
industriell gefertigte Teppichböden, später dann Fertigparkett,
Fliesen
und Korkbeläge. Sie alle machten dem Bodenbelag Linoleum schwer zu
schaffen. Ende der 60er Jahre wurde die Produktion in Deutschland
stark gedrosselt, weltweit mussten zahlreiche Produzenten die
Herstellung sogar ganz einstellen – für Linoleum schien das Ende
gekommen.
Doch Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Es war die
Ökologiebewegung mit ihrem gesteigerten Bewusstsein für natürliche
und wohngesunde Bau- und Werkstoffe, die dem Belag aus
nachwachsenden Rohstoffen seit Mitte der 1980er Jahre eine
Renaissance bescherte. Moderne Dessins und eine frische Farbgebung,
dazu eine umweltschonende und zugleich kostengünstige Produktion
haben Linoleum verloren gegangene Marktanteile zurückerobert. Eine
sehr wichtige Rolle spielt Linoleum im Objektbau: Für
Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime, Büros, Schulen und
Kindergärten ist er aufgrund seiner vielen positiven Eigenschaften
der ideale Bodenbelag.
Fachwissen zum Thema
Baunetz Wissen Boden sponsored by:
Object Carpet GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Telefon: +49 711 3402-0
www.object-carpet.com