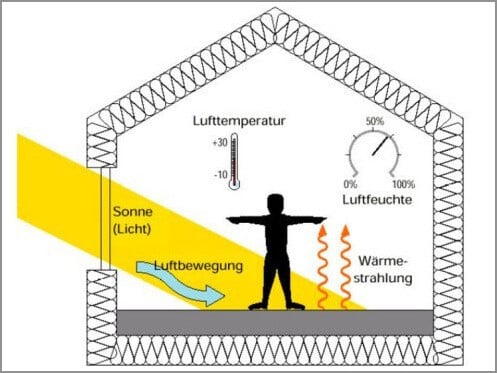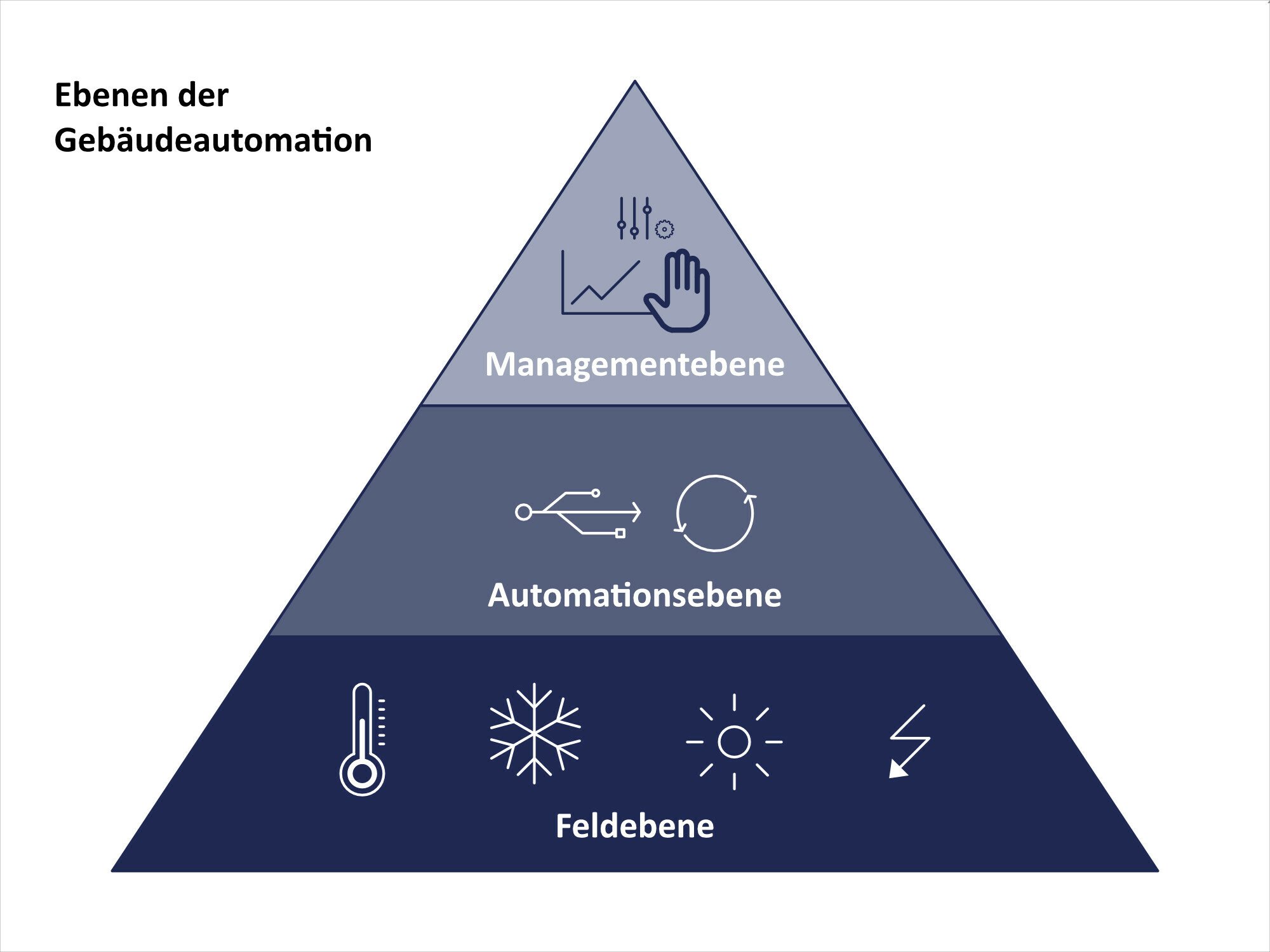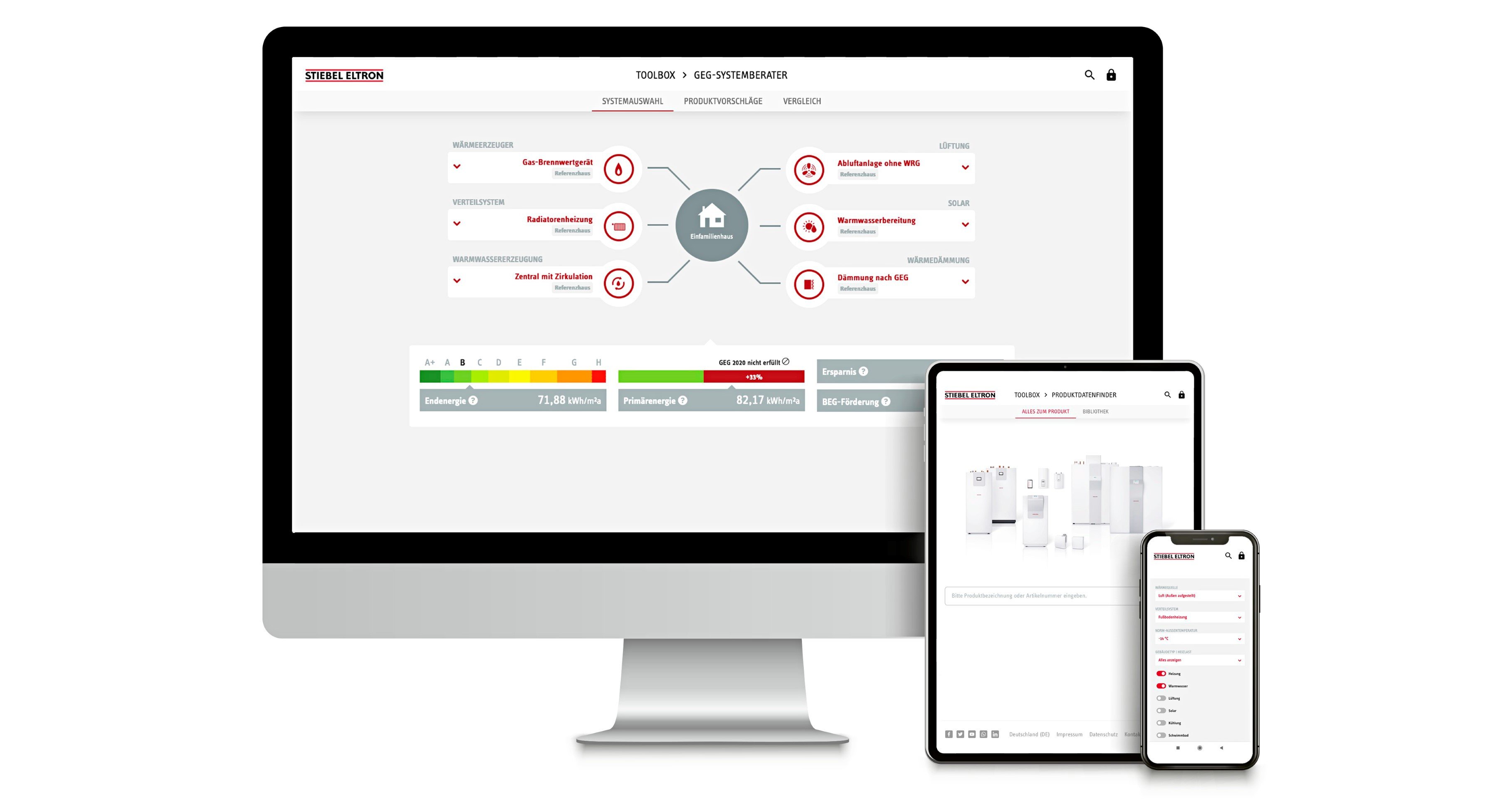Planung der Gebäudetechnik nach GEG
Auswirkungen auf die Anlagenplanung
Die früher geltenden Regelwerke Energieeinsparungsgesetz (EnEG),
Energieeinsparverordnung (EvEV) und
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) wurden zum 1. November
2020 in einem Gesetz zusammengeführt, dem Gebäudeenergiegesetz
(GEG). Darin werden die Anforderungen an Energieeffizienz sowie
erneuerbare Energien gleichermaßen berücksichtigt. Auch die
europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
werden vollständig umgesetzt. Das GEG enthält Anforderungen an die
energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und Verwendung
von Energieausweisen sowie den Einsatz erneuerbarer Energien in
Gebäuden.
Gallerie
Zweck des GEG ist ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie in
Gebäuden, einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer
Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den
Gebäudebetrieb. Das Gesetz soll im Interesse des Klimaschutzes, der
Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von
Energieimporten dazu beitragen, eine weitere Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energie am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu
erreichen. So soll eine nachhaltige Entwicklung der
Energieversorgung ermöglicht werden. Wie bereits bei der
Energiesparverordnung (EnEV) werden Bauherren damit verpflichtet,
ihr Bauprojekt durch entsprechende bau- und anlagentechnische
Maßnahmen energieeffizient zu planen und nachzuweisen.
Für den Nachweis des Energiebedarfs ist die Energiebilanz eines
Gebäudes von zentraler Bedeutung. Sie berücksichtigt zusätzlich zum
eigentlichen Energiebedarf auch vorgelagerte Prozesse wie die Art
der Energiegewinnung oder Verluste bei der Umwandlung des
Energieträgers (Primärenergie). Ihre Berechnung erfolgt auf
Grundlage der DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden -
Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung,
Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung. Um die
Qualität der Energieausweise zu verbessern, gelten strengere
Sorgfaltspflichten für deren Aussteller. Von Eigentümern
bereitgestellt Angaben müssen sie prüfen und dürfen sie nicht
verwenden, wenn Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen. Verstöße
gegen diese Sorgfaltspflicht können Bußgelder zur Folge
haben.
Das GEG unterscheidet hinsichtlich der Anforderungen an Gebäude
zunächst in zu errichtende (Teil 2) und bestehende Gebäude (Teil
3). Teil 4 des GEG geht gesondert auf die Anlagen der Heiz-, Kühl-
und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
ein.
Allgemeine Regeln bei Neubauten und Bestandsbauten
Im GEG ist festgelegt, dass Neubauten als
Niedrigstenergiegebäude zu errichten sind. Demnach darf der
Gesamtenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und
Kühlung (bei Nichtwohngebäuden auch für die eingebaute Beleuchtung)
einen Höchstwert nicht überschreiten (Teil 2, § 10). Dieser
Gesamtenergiebedarf darf das 0,75-fache des
Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes nicht
überschreiten (die Beschreibung eines Referenzgebäudes gab es
bereits bei der EnEV). Wer heute einen Neubau nach dem GEG plant,
muss außerdem nachweisen, dass die Gebäudehülle gut gedämmt und
luftdicht ist – also der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche
bezogene, spezifische Transmissionswärmeverlust die festgelegten
Höchstwerte nicht überschreitet. Gebäude sind so auszuführen, dass
der erforderliche Mindestluftwechsel aus bautechnischen und
hygienischen Gründen sichergestellt ist. Auch für einen
ausreichenden sommerlichen Wärmeschutz nach den anerkannten Regeln
der Technik ist vorgeschrieben, um den Sonneneintrag zu
begrenzen.
Bestehende Gebäude (GEG Teil 3, § 46 bis § 56) bzw.
die Außenbauteile eines bestehenden Gebäudes dürfen nicht in der
Weise verändert werden, dass die energetische Qualität des Gebäudes
verschlechtert wird. Die energetische Bewertung eines bestehenden
Gebäudes erfolgt ebenfalls nach dem Jahres-Primärenergiebedarf für
Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung bezogen auf ein
Referenzgebäude.
In § 3 ist festgelegt, dass der
„Jahres-Primärenergiebedarf“ der jährliche Gesamtenergiebedarf
eines Gebäudes ist, der zusätzlich zum Energiegehalt der
eingesetzten Energieträger und von elektrischem Strom auch die
vorgelagerten Prozessketten bei der Gewinnung, Umwandlung,
Speicherung und Verteilung mittels Primärenergiefaktoren
einbezieht. Die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs unter
Berücksichtigung der Primärenergiefaktoren ist in § 22 sowie
in Anlage 4 beschrieben. Mit dem Einsatz erneuerbarer Energien für
die Gebäudetechnik lassen sich demnach die Zielvorgaben deutlich
leichter erreichen als mit fossilen Energieträgern, die bei der
Berechnung des Primärenergiebedarfs mit höheren
Primärenergiefaktoren bewertet werde. Was dabei „erneuerbare
Energien im Sinne des Gesetzes“ genau sind, ist in § 3,
Abschnitt (2) beschrieben.
Mittlerweile lassen sich erneuerbare Energiequellen auf
vielfältige Weise nutzen. Beispielsweise kann die
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung über eine
solarthermische Anlage erfolgen. Zur Erzeugung von Heizenergie
bieten Wärmepumpen (auch in Kombination mit Solarthermie und Photovoltaik) eine gute Lösung
nach Stand der Technik. Wichtig bei der Nutzung von erneuerbarer
Energie ist auch deren Speicherung.
Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
Wie bei Bestandsgebäuden, so gibt es auch bei Anlagen und
Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung das Verbot, sie in einer Weise zu verändern,
dass die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtert wird.
Anlagen und Einrichtungen müssen vom Betreiber sachgerecht bedient,
regelmäßig fachkundig gewartet und instandgehalten werden.
Zentralheizungen müssen mit zentralen, selbsttätig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr
sowie zum Ein- und Ausschalten elektrischer Antriebe in
Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit versehen sein. Auch
andere heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen
mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der
Temperatur ausgestattet sein. Umwälzpumpen in Zentralheizungen mit
mehr als 25 Kilowatt Nennleistung müssen den betriebsbedingten
Förderbedarf selbstständig in mindestens drei Stufen anpassen
können. Zirkulationspumpen in Warmwasseranlagen müssen mit einer
selbsttätig wirkenden Einrichtung zur Ein- und Ausschaltung
ausgestattet werden.
Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung für den
Kältebetrieb von mehr als zwölf Kilowatt und raumlufttechnischen
Anlagen, die für einen Volumenstrom der Zuluft von
wenigstens 4.000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, sowie bei der
Erneuerung von Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher
Anlagen müssen diese so eingerichtet sein, dass bei
Auslegungsvolumenstrom der Grenzwert für die spezifische
Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3: Energetische Bewertung
von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 3: Lüftung von
Nichtwohngebäuden - Leistungsanforderungen an Lüftungs- und
Klimaanlagen und Raumkühlsysteme nicht überschritten
wird.
Die installierten Anlagen müssen selbsttätig wirkende
Regelungseinrichtungen besitzen, bei denen getrennte Sollwerte für
die Be- und die Entfeuchtung eingestellt werden können und als
Führungsgröße mindestens die direkt gemessene Zu- oder
Abluftfeuchte dient. Die technischen Komponenten, die den Wirkungsgrad beeinflussen, sind durch regelmäßige
energetische Inspektionen zu überprüfen.
Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen müssen
von Bauherren (im Falle der Neuinstallation) oder Eigentümern (im
Falle des Ersetzens) mit einer Begrenzung der Wärmeabgabe
ausgestattet werden (§ 69). Gleiches gilt für
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen, die zu
Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik gehören
(§ 70). Die Anforderungen an die Wärmedämmung von
Rohrleitungen und Armaturen sind in Anlage 8 des GEG
beschrieben.
Nachrüstung und Betriebsverbot bestehender Anlagen
Eigentümer von Gebäuden sind verpflichtet, veraltete Heizkessel
auszutauschen. Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen
Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut
oder aufgestellt wurden, dürfen nicht mehr betrieben werden
(§ 72). Kessel, die ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder
aufgestellt wurden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr
betrieben werden. Ausgenommen sind lediglich
Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie
Heizungsanlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder
mehr als 400 Kilowatt beträgt. Zusätzlich ist vorgeschrieben, dass
bisher ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen bei heizungstechnischen Anlagen sowie
Armaturen, die sich nicht in beheizten Räumen befinden, zur
Begrenzung der Wärmeabgabe zu dämmen sind. Ab dem 1. Januar 2026
dürfen Heizkessel, die mit Heizöl oder mit festem fossilem
Brennstoff beschickt werden, zum Zwecke der Inbetriebnahme in ein
Gebäude nur noch in seltenen Fällen eingebaut oder aufgestellt
werden (siehe § 72, Abschnitt (4)).
Ausnahmen dieser Pflicht zum Austausch besteht nur bei einem
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der
Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat. Die
Austauschpflicht besteht dann erst bei einem Eigentümerwechsel. Die
Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre (§ 73).
Einen ersten Überblick über das GEG gibt die Broschüre „Das Gebäudeenergiegesetz – Die wichtigsten Änderungen durch das neue Gesetz im Überblick“ der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch ASUE (siehe Surftipps).
Fachwissen zum Thema
Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:
Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de