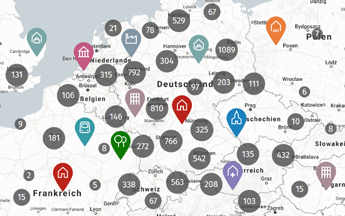Kö-Bogen II in Düsseldorf
Acht Kilometer Hainbuchhecken
Europas derzeit größte Grünfassade befindet sich in Düsseldorf.
Sie gehört zum Kö-Bogen II, einem zweiteiligen Geschäfts-
und Bürogebäude, das mit mehr als 30.000 Hainbuchen-Heckenpflanzen
ein Pilotprojekt zum Thema Städte- und Klimawandel
darstellt.
Gallerie
Mit Fertigstellung des von Ingenhoven Architects geplanten Gebäudes ist die umfangreiche städtebauliche Neuordnung am Gustav-Gründgens-Platz in der Innenstadt abgeschlossen. Sie begann 2005 und umfasste in mehreren Bauabschnitten neue Büro-, Einzelhandels- und Gastronomienutzungen. Im Jahr 2013 erfolgte die Überbauung eines ehemaligen Verkehrsknotens mit zwei von Daniel Libeskind entworfenen Gebäuden. Zeitgleich wurde der sogenannte Tausendfüßler, eine 1962 fertiggestellte und 1993 unter Denkmalschutz gestellte Hochstraße, abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt.
Neubau und Stadtraum
Der zweiteilige Neubau besteht aus einem fünfgeschossigen, trapezförmigen Hauptgebäude und einem kleineren Nebengebäude mit dreieckigem Grundriss und begehbarem schrägen Dach. Dazwischen liegt der neue, südwestliche Zugang zum Gustaf-Gründgens-Platz mit Blick auf Dreischeibenhaus, Schauspielhaus und den dahinterliegenden Hofgarten. Das Hauptgebäude ist in neun unterschiedlich große Segmente unterteilt, die sich entlang der Schadowstraße im Süden aufreihen, während das Nebengebäude nach Westen auf die Hofgartenstraße ausgerichtet ist. Auf einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 42.000 Quadratmetern bietet der Neubau Platz für Einzelhandel, Gastronomie, Büro und Erholung. Unter dem Gustav-Gründgens-Platz befindet sich eine Tiefgarage mit einer Bruttogeschossfläche von 23.000 Quadratmetern.
Gallerie
Glas- und Grünfassaden
Die 27 Meter hohe und 120 Meter lange Südfassade des Hauptgebäudes ist komplett verglast, ebenso die beiden Dreiecksfassaden des Nebengebäudes. Dagegen sind die zum Gustaf-Gründgens-Platz weisenden Fassaden des Hauptgebäudes fast vollständig begrünt. Im Erdgeschoss markieren trapezförmige Aussparungen die Eingänge, im dritten Obergeschoss wird die begrünte Fläche von einem umlaufenden Glasband durchbrochen. In die zum Gustaf-Gründgens-Platz sich neigende Dachfläche sind zwei trapezförmige Höfe eingeschnitten. Das dreieckige Pultdach des zehn Meter hohen Nebengebäudes ist als begehbare Rasenfläche ausgebildet.
Begrünung mit wissenschaftlicher Unterstützung
Das vegetationstechnische Konzept der Grünfassade entwickelte das Planungsteam gemeinsam mit dem Botaniker Karl-Heinz Strauch von der Beuth Hochschule Berlin, beratend zur Seite standen ihnen Fachleute des Unternehmens Optigrün. Untersucht wurden das Wachstum, die Pflege und der Beschnitt der Pflanzen, die Wasser- und Nährstoffversorgung sowie die ökophysiologische Leistungsfähigkeit in speziellen Pflanzgefäßen. Außerdem wurden der Wasser- und Wärmehaushalt der Laubfläche, wie auch die die CO₂-Aufnahme der 1,30 m hohen Hainbuchen getestet.
Dachbegrünung Hauptgebäude
Das rund 2.500 Quadratmeter große Dach des Hauptgebäudes wurde nach konventioneller Methode als Ballenware in Pflanzenbeeten begrünt. Die Herausforderung ergab sich durch die Schräge des Daches. Aufgrund des Höhenunterschieds von 5,00 Metern vom Hoch- zum Tiefpunkt wurde das Dach mittels bauseitiger Schwellen in Entwässerungssegmente eingeteilt. Innerhalb dieser Segmente wurde dann ein Gartendach mit Drän- und Wasserspeicherelementen auf einem Umkehrdach realisiert. Durch eine Windsogberechnung konnte sowohl die Stabilität der Bepflanzung als auch die Lagesicherheit des Umkehrdach-Aufbaus nachgewiesen werden.
Dachbegrünung Nebengebäude
Das etwa 12 Grad geneigte Dach des Nebengebäudes bedeckt eine Rasenfläche. Ein Schubsicherungssystem sorgt dafür, dass sie der hohen Belastung durch bis zu 1.000 Personen standhält. In die Schrägdachsicherung mit Schubträgern und -schwellen sind Unterflur-Tropfschläuche für die automatische Tröpfchen-Bewässerung des Rasens integriert. Das Substrat wurde in mehreren Durchläufen eingeschlämmt und abgewalzt, um eine hohe Verdichtung zu erzielen. Darauf wurde erst ein Geogitter, dann extra starke Fertigrasensoden verlegt, die eine sehr gute Durchwurzelung des Rasens und damit eine hohe Zugfestigkeit sicherstellen. Die etwa 1.000 kg schweren, 120 cm breiten und rund 1.500 cm langen Rasenrollen wurden mittels Traverse an einem Kran hängend abgerollt und verlegt.
Gallerie
Fassadenbegrünung in über 500 Tragbehältern
Die Hainbuchen der Fassadenhecken aus wachsen in einem speziellen Begrünungssystem aus horizontalen, terrassenförmig angeordneten Behältern, sogenannten Primärgefäßen. Diese wurden in Tragbehälter eingesetzt, die über eine Konsolen-Konstruktion vor der 60 Grad geneigten, wärmegedämmten Betonfassade befestigt sind.
Die mehr als 500 Tragbehälter sind 4,00 m lang, etwa 0,50 m hoch und tief und mit je zwei Entwässerungsleitungen versehen. Alle Be- und Entwässerungsleitungen wurden in die Tragkonstruktion integriert. Die Hecken werden mit Regenwasser bewässert, das bei Starkregen in Zisternen gesammelt wird. Wassermenge, Bewässerungsintervall und Nährstoffmenge werden über Messungen bedarfsorientiert geregelt. Die Pflanzen wurden drei Jahre in einer Baumschule gezüchtet, bevor sie im Herbst 2019 in den Primärgefäßen mit voll ausgebildeten Wurzeln auf die Baustelle kamen. Über Laufstege erreichbar, werden sie drei Mal im Jahr per Hand geschnitten. Die Wahl fiel aus mehreren Gründen auf Hainbuchen: Es sollten heimische Pflanzen sein, die ihr Erscheinungsbild im Jahresverlauf wandeln. Im Winter reduziert sich der Wasserbedarf auf ein Minimum, was die Gefahr von Trockenschäden verringert.
Gallerie
Ökologischer Nutzen
Die vegetationstechnische Untersuchung ergab, dass der
ökologische Nutzen der Hainbuchen rund 80 ausgewachsenen Laubbäumen
entspricht, vor allem im Hinblick auf die Sauerstoffproduktion und
das Binden von Feinstaub. Die Bepflanzung verhindert aber auch,
dass sich Fassade- und Dach bei starker Sonneneinstrahlung bis zu
70 Grad aufheizen und diese Wärme an die Umgebungsluft abgeben.
Stattdessen wirken die Hainbuchen als Hitzepuffer positiv auf das
Mikroklima des Quartiers und geben zudem Feuchtigkeit über die
Blätter ab und kühlen so die Umgebungsluft durch die entstehende
Verdunstung. Darüber hinaus dämpfen die Pflanzen den Lärm und
fördern die Biodiversität.
Bautafel
Architektur: Ingenhoven Architects, Düsseldorf
Projektbeteiligte: AIP Bauregie, Düsseldorf (Projektmanagement); Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft, Düsseldorf (Tragwerksplanung); Heinz Jahnen Pflüger – Stadtplaner und Architekten Partnerschaft, Aachen (Bebauungsplanverfahren); ICG Düsseldorf (Geotechnische Beratung); Prof. Dr. Karl-Heinz Strauch, Beuth Hochschule für Technik, Berlin (Phytotechnologie / Spezielle Bauwerksbegrünung); Prof. Dr. Reif, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg (Beratung für Vegetationsökologie); ArGe Carpinus Kö-Bogen II: Jakob Leonhards Söhne, Wuppertal und Benning Dachbegrünung, Havixbeck (Ausführung Gründächer und Fassade); Bruns, Bad Zwischenahn (Lieferung und Aufzucht Hainbuchen); Optigrün international (Fassadeninnengefäße, Dachbegrünung und Planungsunterstützung)
Bauherr*in: Düsseldorf Schadowstraße 50/52; Centrum Projektentwicklung, Düsseldorf; B&L Gruppe, Hamburg
Fertigstellung: 2020
Standort: Schadowstraße 50-52, 40215 Düsseldorf
Bildnachweis: Hans Georg Esch, Hennef / Ingenhoven Architects, Düsseldorf, Optigrün international und Leonhards, Wuppertal
Baunetz Architekt*innen
Fachwissen zum Thema
Bauwerke zum Thema
Optigrün international AG | Kontakt +49 7576 772-0 | www.optigruen.de