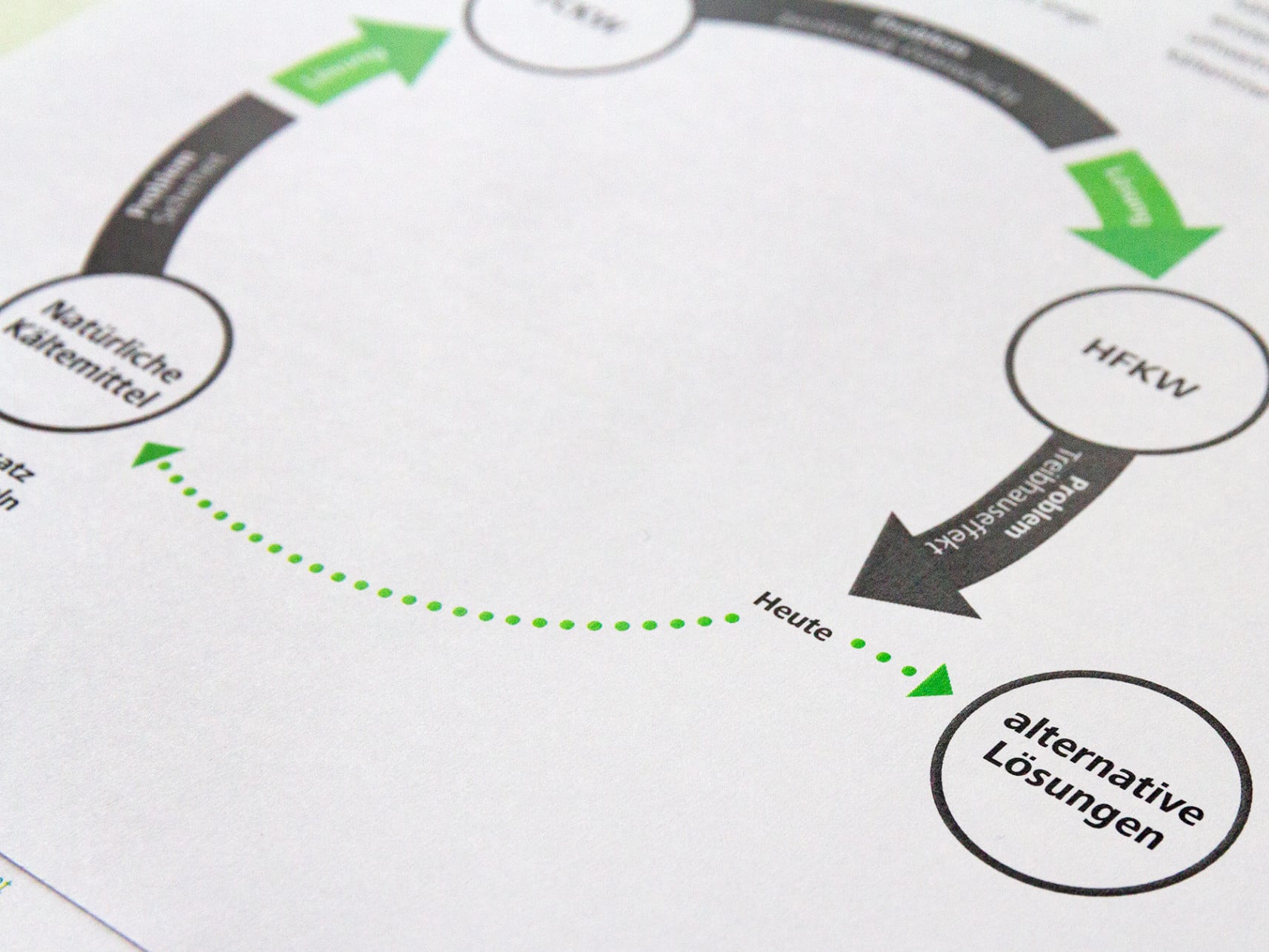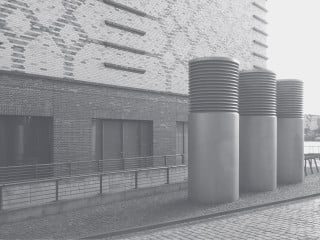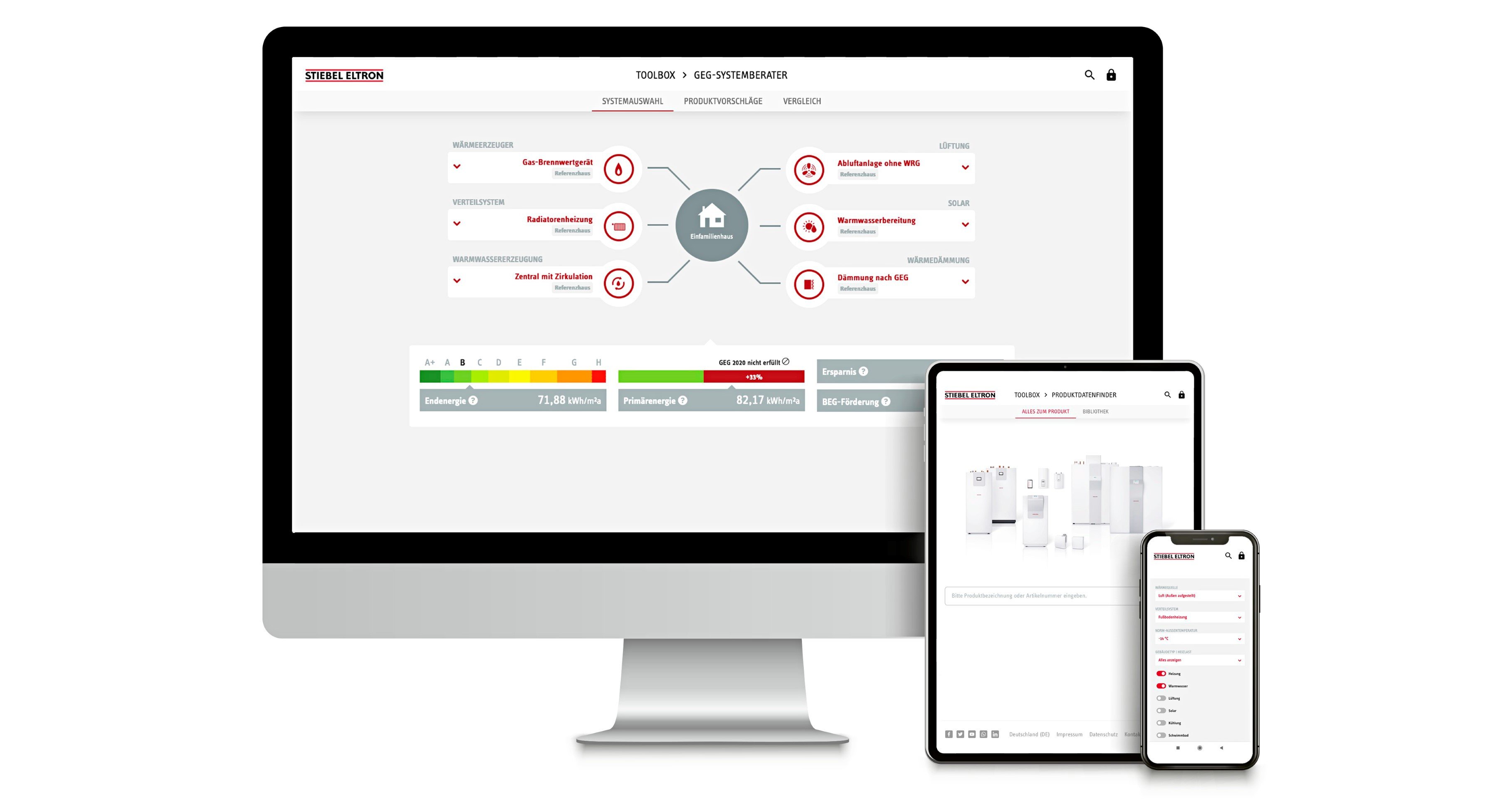Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Gallerie
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde im Jahr 2000
von der Bundesregierung mit dem Ziel verabschiedet, den Anteil
erneuerbarer Energien an der Stromversorgung in Deutschland
deutlich zu erhöhen und so den Ausstoß klimaschädlicher
Treibhausgasemissionen zu senken.
Geplanter Anteil erneuerbarer Energien an der
Stromproduktion:
- Jahr 2020: 35 Prozent
- Jahr 2025: zwischen 40 und 45 Prozent
- Jahr 2030: mindestens 50 Prozent
- Jahr 2035: zwischen 55 und 60 Prozent
- Jahr 2040: mindestens 65 Prozent
- Jahr 2050: mindestens 80 Prozent.
Um diese Ziele zu erreichen, erhält Strom aus erneuerbaren
Quellen bei der Einspeisung ins Netz Vorrang gegenüber Strom, der
mit fossilen Brennstoffen wie Steinkohle, Braunkohle oder Erdgas
produziert wurde.
Vergütung
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, Anlagen, die Strom aus Wind,
Sonne oder Biomasse erzeugen, ans Netz anzuschließen, den
erzeugten Strom vorrangig abzunehmen und entsprechend zu vergüten.
Die Anlagenbetreiber erhalten für einen festen Zeitraum von 20
Jahren nach der Inbetriebnahme eine garantierte Einspeisevergütung
für jede eingespeiste Kilowattstunde beziehungsweise eine
Marktprämie.
EEG-Umlage und Ausgleichsregelung
Die an die Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen sind höher als
die Erlöse, die die Netzbetreiber mit dem Verkauf des erzeugten
EEG-Stroms auf dem Markt erzielen. Die Differenz wird mithilfe der
EEG-Umlage ausgeglichen. Sie wird von den Stromkunden über den
Strompreis bezahlt. Die EEG-Umlage ist nicht für alle Verbraucher
gleich hoch. Für stromintensive Unternehmen, die im internationalen
Wettbewerb mit anderen Firmen stehen, gilt die „Besondere
Ausgleichsregelung“. Sie zahlen nur eine reduzierte EEG-Umlage. Der
durch die Befreiung fehlende Anteil wird von den Privathaushalten
und den nicht privilegierten Unternehmen mitbezahlt.
EEG-Novellen
Seit das EEG in Kraft getreten ist, wurde es mehrmals überarbeitet
und die Höhe der Vergütung für die Einspeisung von EEG-Strom an die
jeweilige Marktentwicklung angepasst. Novelliert wurde das EEG in
den Jahren 2004, 2009, 2012, 2014 und zuletzt 2017.
EEG-Novelle 2014
Bereits ab 2009 führte der starke Anstieg von erneuerbar
produziertem Strom zu fallenden Börsenstrompreisen. Zugleich wuchs
die Zahl der von der EEG-Umlage befreiten Industriebetriebe. Beides
ließ die EEG-Umlage massiv ansteigen – von 1,12 Cent/Kilowattstunde
im Jahr 2008 auf 6,24 Cent/Kilowattstunde in 2014. Zudem stellte
der wachsende Anteil von Strom aus fluktuierenden Energiequellen
wie Wind und Sonne die Stromnetze in puncto Stabilität und
Versorgungssicherheit zunehmend vor Herausforderungen.
Um die EEG-Umlage zu stabilisieren und den Zubau von
Erneuerbare-Energien-Anlagen besser zu steuern, wurde das EEG im
Jahr 2014 grundlegend reformiert. Für Solarenergie, Windenergie und
Biomasse wurden konkrete Mengenziele – sogenannte Ausbaukorridore –
für den jährlichen Zubau festgelegt. Die Steuerung erfolgt über
einen „atmenden Deckel“: Werden mehr Anlagen in Betrieb genommen
als nach dem Ausbaukorridor vorgesehen, sinken automatisch die
Fördersätze für die weiteren Anlagen.
Betreiber von größeren Neuanlagen zur Stromproduktion sind
verpflichtet, den erzeugten Strom direkt zu vermarkten. Dies gilt
ab 1. Januar 2016 für alle Neuanlagen ab einer Leistung von 100
Kilowatt. Eine staatlich festgelegte Einspeisevergütung gibt es für
diese Anlagen nicht mehr, dafür aber eine Marktprämie zusätzlich
zum erzielten Erlös im Rahmen der Direktvermarktung.
Für Anlagen zur Eigenstromerzeugung, die neu errichtet werden, muss
erstmals die EEG-Umlage bezahlt werden. Ausgenommen sind
Kleinanlagen mit einer Leistung von maximal zehn Kilowatt bei einem
jährlichen Eigenstromverbrauch unter zehn Megawattstunden. Das
betrifft zum Beispiel private Stromerzeuger mit
Photovoltaik-Anlagen auf dem Hausdach. Eigenverbraucher von Strom
aus Photovoltaik-Anlagen, deren installierte Leistung zehn Kilowatt
übersteigt, bezahlen ab 2017 40 Prozent der EEG-Umlage.
EEG-Novelle 2017
Das EEG 2017 brachte einen
Paradigmenwechsel: Seit 2017 wird die Höhe der Vergütung, die
Erzeuger von erneuerbarem Strom erhalten, nicht mehr staatlich
festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt. Den
Zuschlag bekommt, wer die geringste Vergütung verlangt.
Bei der Photovoltaik gilt dies erst für größere Anlagen ab einer
installierten Leistung von 750 Kilowatt. Photovoltaik-Anlagen mit
geringerer Leistung, wie sie zum Beispiel bei Ein- und
Mehrfamilienhäusern installiert sind, haben je nach Technologie und
Größe der Anlage weiterhin einen gesetzlich festgelegten
Förderanspruch für den eingespeisten Strom. Betreiber von Anlagen
über 100 Kilowatt Leistung müssen wie bereits im EEG 2014
vorgesehen, den Strom direkt vermarkten und erhalten zusätzlich
eine Marktprämie. Anlagen mit einer installierten Leistung bis 100
Kilowatt erhalten nach wie vor eine feste Einspeisevergütung. Auch
die Regeln des EEG 2014 zur EEG-Umlage bei der Eigenstromerzeugung
gelten weiter.
Als weitere Neuerung verknüpft das EEG 2017 die Stromerzeugung
stärker mit dem Ausbau der Stromnetze. Beispielsweise wird in
Gebieten mit Netzengpässen der Ausbau der Windkraft an Land
beschränkt.
Fachwissen zum Thema
Surftipps
Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:
Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de