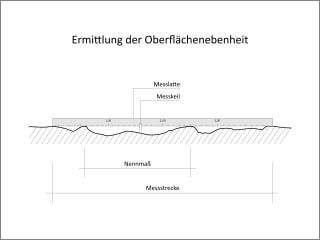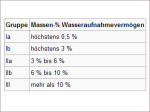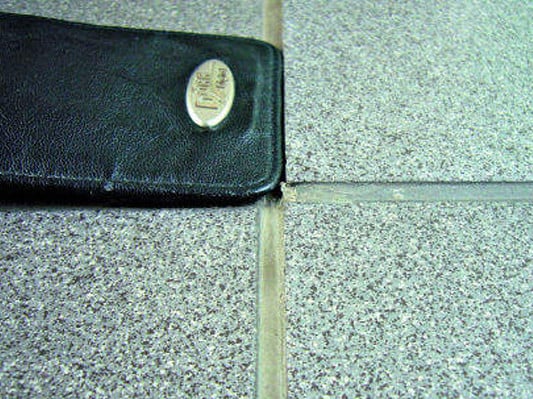Feuchteschäden
Gallerie
Bei Feuchteschäden an Fliesenbelägen muss unterschieden werden
zwischen Schäden, die aus Feuchtigkeit resultieren, welche bei der
Verlegung unter den Fliesen eingeschlossen wurde und Schäden, die
durch später eingedrungene Feuchtigkeit entstehen.
Durch die Fliesen selber kann Feuchtigkeit kaum in den Untergrund
gelangen. Steingut- und (echte) Cottofliesen mit ihrer hohen
Wasseraufnahmefähigkeit sind heute selten
geworden. Bereits das feinkeramische Steinzeug (mit einer
Wasseraufnahmefähigkeit zwischen 0,5 und 3%) gilt als frostsicher,
weil es kaum mehr Wasser durchlässt. Am weitaus häufigsten
allerdings sind mittlerweile die sogenannten Feinsteinzeugfliesen (mit einer
Wasseraufnahmekapazität von unter 0,5%) anzutreffen. Die
technologisch führenden Hersteller produzieren heute bereits
unglasiertes technisches Feinsteinzeug mit einer
Wasseraufnahme-Kapazität von nur 0,03 bis 0,04%. Wenn man bedenkt,
dass Glas eine Wasseraufnahme-Kapazität von etwa 0,02% hat wird
verständlich, warum bei der Herstellung des Materials von
„Verglasung“ gesprochen wird.
Feuchtigkeit – und mit ihr auch Schadstoffe – können von oben also
nur über die Fugen in den Untergrund eindringen. Verfugungen
bei keramischen Belägen sind nämlich immer wasserdurchlässig. Ist
also mit einer Wasserbelastung der Flächen (wie zum Beispiel in
einem Schwimmbad) zu rechnen, so wird eine zusätzliche Abdichtung
zwingend erforderlich (siehe Zum Thema „Abdichtungen“ und
„Fugen“).
Mindestens ebenso problematisch wie eindringendes Wasser ist unter
dem Fliesenbelag eingeschlossenes Wasser. Dieses kann entweder als
nachschiebende Feuchtigkeit in den Untergrund gelangen oder aus den
Verlegewerkstoffen (zum Beispiel dem Mörtel) stammen und keine
ausreichenden Möglichkeiten haben, dort zu entweichen. Je größer
die Fliesen und je kleiner die Fugen, desto erschwerter die
Diffusion. Zunächst einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass an der Baustelle nach wie vor nur eine einzige Methode
zugelassen ist, die Restfeuchte des Untergrundes zu ermitteln:
nämlich die CM-Messung (CM = Carbid-Methode). Ein
schwimmender Estrich sowie ein Estrich auf Trennlage sind erst
dann verlegereif (für die Aufnahme von keramischen Belägen), wenn
sie folgende Restfeuchtewerte nicht überschreiten:
- Zementestriche: 2,0 CM-%
- calciumsulfatgebundene Estriche: 0,5 CM-%
- beheizte calciumsulfatgebundene Estriche: 0,3 CM-%