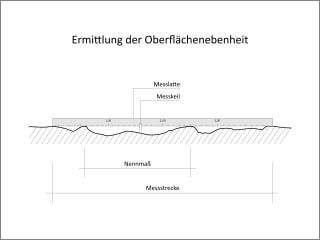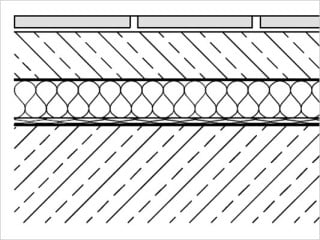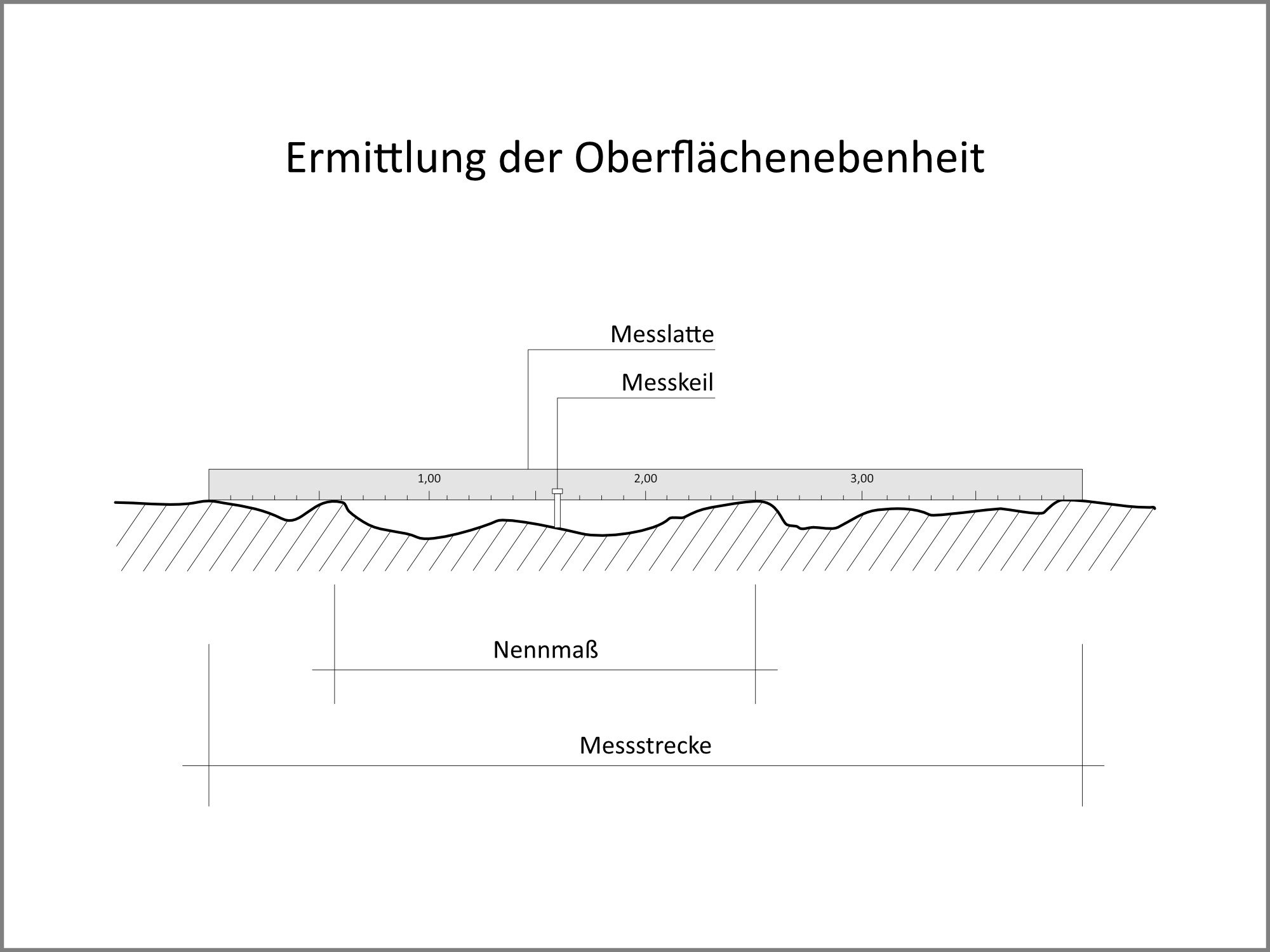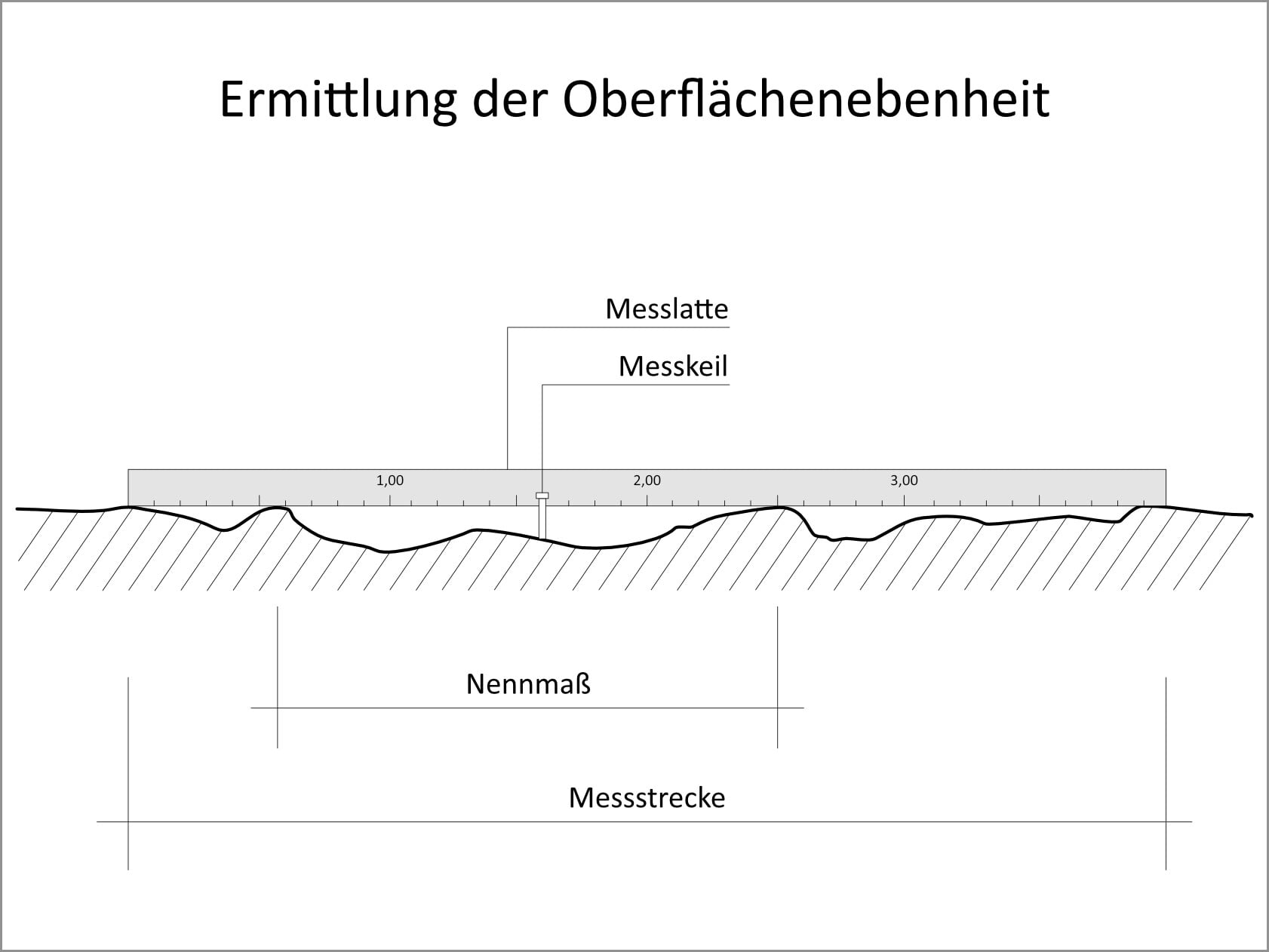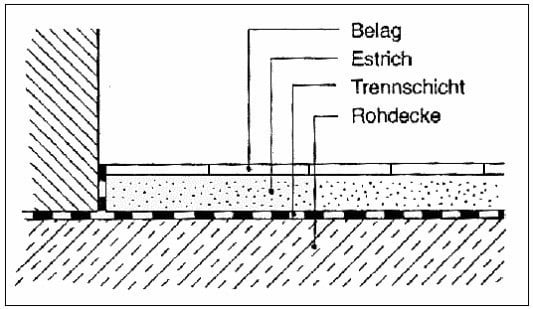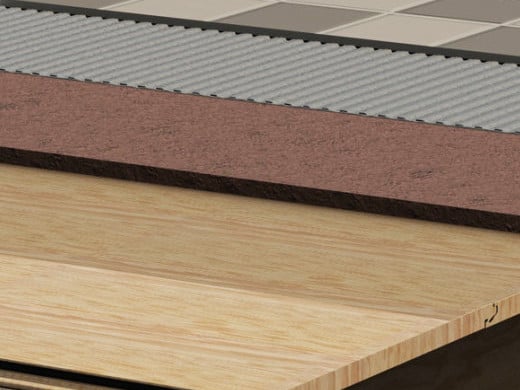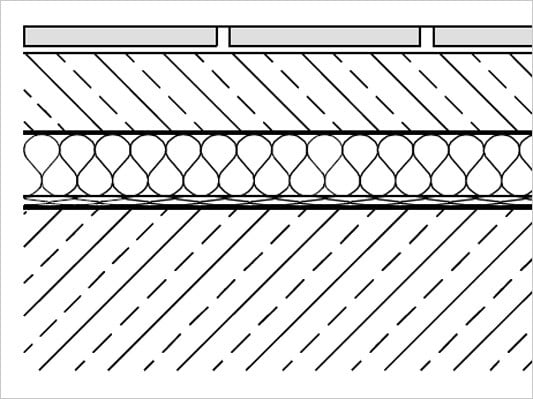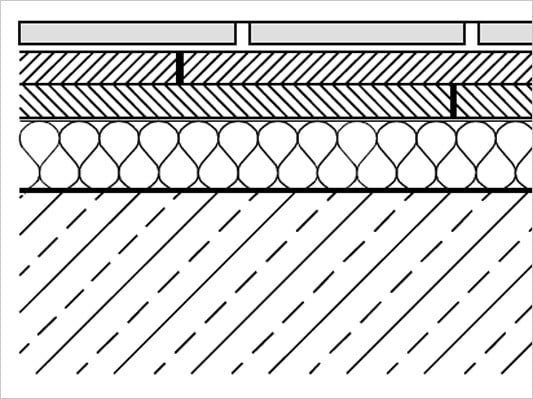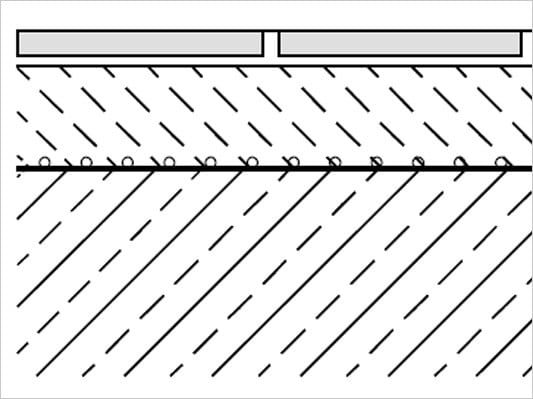Heizestrich/Fußbodenheizung
Gallerie
Als Heizestrich wird ein schwimmender Estrich
bezeichnet, der entweder in oder unterhalb der
Lastverteilungsschicht mit Heizelementen für die Raumheizung
versehen ist. Je nach Lage der Heizelemente werden Heizestriche in
die drei Bauarten A, B und C unterteilt:
- Bauart A für nass verlegte Systeme
Das Heizelement ist im Estrich eingebettet. Mit gut wärmeleitenden Estrichen sind bei dieser Bauart günstige Wärmeabgabewerte zu erreichen.
- Bauart B für trocken verlegte Systeme
Das Heizelement liegt unter dem Estrich in bzw. auf der Dämmschicht. Wichtig ist eine geeignete Wärmeabgabe zum Beispiel durch Leitbleche an den Estrich. Bei dieser Bauart sind Bewegungsfugen einfach herzustellen, da sie an keiner Stelle auf Heizelemente treffen. Das System kann mit einem Fertigteilestrich kombiniert werden.
- Bauart C für nass verlegte Systeme
Das Heizelement liegt in einem Ausgleichestrich, der durch eine zweilagige Trennschicht vom lastverteilenden Estrich getrennt ist. Die Dicke des Ausgleichestrichs muss mindestens 20 mm größer sein als der Durchmesser der Heizelemente. Die Estrichnenndicken oberhalb der Trennschicht richten sich nach den Anforderungen für unbeheizt schwimmende Estriche nach DIN 18560-2 Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche). Die Fugen können frei verlaufen.
In Heizestrichen können entweder Warmwasserrohrsysteme aus Metall- oder Kunststoffrohren oder Elektroheizsysteme aus Heizmatten oder Heizkabeln zur Ausführung kommen. Die Temperatur des Heizelementes ist abhängig von der gewünschten Oberflächentemperatur, der Bindemittelart, der Estrichdicke sowie der Art des Bodenbelags. Sowohl bei Warmwasser- als auch bei Elektro-Fußbodenheizungen darf die mittlere Temperatur im Bereich der Heizelemente im Estrich bei Gussasphaltestrichen 45°C, bei Calciumsulfat- und Zementestrichen 55°C jedoch nicht überschreiten.
Dämmstoffe unter Heizestrichen dürfen maximal eine Zusammendrückbarkeit von 5 mm aufweisen. Bei elektrischer Beheizung muss die obere Dämmstofflage kurzzeitig gegen Temperaturen von 90 °C beständig sein.
Wichtige technische Regelwerke für Heizestriche:
- DIN 18560-2 Estriche im Bauwesen – Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)
- DIN EN 1264-4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung – Teil 4: Installation
- DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche – Begriffe
- DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche –
Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und
Anforderungen
- Merkblatt „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen”
Belegen mit Fliesen und Platten
Grundsätzlich gilt für Heizestriche bzw. beheizte
Lastverteilungsschichten in Bezug auf Fliesen- und Plattenarbeiten
das Gleiche, wie dieses bereits bei schwimmenden Estrichen
aufgeführt wurde. Ergänzend ist bei Heizestrichen jedoch darauf zu
achten, dass zum einen niedrigere Feuchtigkeitsgehalte des
Untergrundes hinsichtlich der Belegreife gelten. Zur Aufnahme von Fliesen
und Platten gilt für Zementestriche eine Belegreife von < 1,8
CM-% entgegen üblichen/unbeheizten Zementestrichen, wo < 2,0
CM-% erforderlich sind. Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen
gelten für Heizestriche < 0,3 CM-% entgegen bei unbeheizten
Estrichen mit < 0,5 CM-%. Zum anderen ist bei Heizestrichen
darauf zu achten, dass für Estriche mit Warmwasserfußbodenheizung
ein so genanntes „Belegreifheizen“ gemäß dem Merkblatt
„Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“
erforderlich ist. Ein entsprechendes Aufheizprotokoll ist dem
Auftragnehmer Fliesen- und Plattenarbeiten als Nachweis zur
Belegreife zu übergeben.
Unabhängig davon sind bei Heizestrichen entsprechende Messstellen
für Feuchtigkeitsmessungen (CM-Messungen) im Estrich
auszuweisen und zu markieren und der Auftragnehmer Fliesen- und
Plattenarbeiten sollte die Belegreife des Estrichs immer im Rahmen
einer CM-Feuchtigkeitsbestimmung überprüfen. Die Markierungen sind
der Tatsache geschuldet, dass die Heizleitungen innerhalb der
Zementestrichkonstruktion beim Aufstemmen des Fußbodens nicht
beschädigt werden sollen.
Einen weiteren wichtigen Punkt stellen bei Heizestrichen die
Temperaturbelastungen dar. Im Nachfolgenden sind einige
Wärmeausdehnungskoeffizienten verschiedener Estricharten
aufgeführt:
- Zementestrich: ca. 0,012 mm/mK
- Calciumsulfatestrich: ca. 0,010 mm/mK
- Calciumsulfatfliesestrich: ca. 0,08 mm/mK bis 0,016 mm/mK
- Gussasphaltestrich: ca. 0,035 mm/mK
- Magnesiaestrich: ca. 0,005 mm/mK
Für die unten aufgeführten Nutzbeläge gelten u. a. folgende
Wärmeausdehnungskoeffizienten:
- Granit, keramische Fliesen: ca. 0,006 mm/mK
- Steingut/Steinzeug: ca. 0,007 mm/mK
- Kalkstein: ca. 0,005 mm/mK
- Marmor: ca. 0,004 mm/mK
- Polyestergebundene Kunststeine: ca. 0,030 mm/mK
Daraus ergeben sich Zugspannungen, welche durch die Konstruktion und insbesondere im Oberbelag aufgefangen und verkraftet werden müssen, andernfalls kommt es zu Rissbildungen. Aus den genannten Gründen kommt den Bewegungsfugen innerhalb der Fußbodenkonstruktion bei beheizten Estrichen eine besondere Bedeutung zu.
Zur Aufnahme von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein und Betonwerkstein gelten in etwa folgende Feldgrößen:
Zementestriche:
- maximale Seitenlänge: < 8 m
- maximale Gesamtfläche ca.: < 40 m²
- maximale Seitenlänge: < 10 m
- maximale Gesamtfläche ca.: < 100 m²