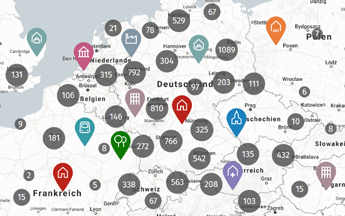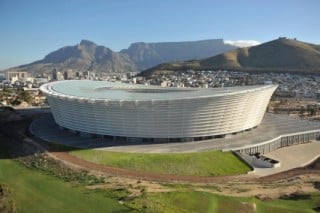Erweiterung Museum Rietberg in Zürich
Zentral gesteuerte Sicherung der Kunstschätze mit Funkbildermeldern
Die Villa Wesendonck ist seit 1952 Sitz des Museums Rietberg. Vom Schweizer Architekten Leonhard Zeugheer Mitte des 19. Jahrhunderts für das Ehepaar Wesendonck erbaut, gehört sie zusammen mit dem ausgedehnten Park zu den herausragenden Baudenkmälern Zürichs. Schon lange bot sie nicht mehr genügend Raum für die umfangreiche Sammlung außereuropäischer Kunst. Die Arbeitsgemeinschaft des österreichischen Architekten Adolf Krischanitz und des Schweizers Alfred Grazioli konnte den Wettbewerb zur Erweiterung für sich entscheiden, weil sie die neuen Volumen unterirdisch planten und der Bestand äußerlich unangetastet bleibt. Dennoch sind die neuen Ausstellungsräume gut an die Villa angebunden.
Gallerie
Das Museum besteht nun aus vier miteinander verbundenen Einheiten: Dem Neubau mit einem Schwerpunkt auf chinesischer und japanischer Kunst, der alten Villa Wesendonck mit indischer, pakistanischer und indonesischer Kunst, der Park-Villa Rieter mit Kunst aus dem Iran und dem Schaudepot mit den hell erleuchteten Magazinräumen.
Der zweigeschossige Neubau liegt über 12 m tief in einem Moränenhügel vergraben und übertrifft mit einer Grundfläche von 1600 m² bei weitem den Bestand. Dieser musste während der Bauarbeiten teilweise mit einer massiven Stahlkonstruktion unterfangen werden. Die Villa und das bestehende Ökonomiegebäude formen nun wie zuvor einen Platz mit Pergola, der aber eine weitere Begrenzung erhalten hat: Dem Wintergarten gegenüberliegend, wächst das neue gläserne Foyer aus einem Hügel heraus und bildet den Zugang zum Museum. Der Raum zwischen Alt- und Neubau ist mit Holz gepflastert.
Die tragenden Elemente des Neubaus sind Lamellen aus Glas, die bedruckt sind mit dem vergrößerten Kristallgitter eines Smaragdes. So entstehen lebhafte Durchblicke und Spiegelungen. Ein schmaler Windfang gibt Zutritt zum Foyer mit Garderobe, Kasse und Museumsshop. Mit einer Leuchtdecke aus durchscheinenden Onyxplatten erhält das Foyer eine edle Atmosphäre. Die Rasterung der Decke mit der sichtbaren Rahmung der Platten gibt dem stützenfreien Raum eine optische Gliederung; die Rastermaße entsprechen denen des alten Wintergartens. An der Rückwand des Foyers bildet ein massives Betonrelief des Künstlers Helmut Federle den Blickfang.
Von hier aus wird das Untergeschoss mit den Ausstellungsräumen über eine zweiläufige Treppe mittig erschlossen. Im ersten Untergeschoss umschließen massive Wände aus wasserdichtem Beton einen zentralen Raum, der von flexibel teilbaren Räumen umgeben ist. Die Wände sind in verschiedenen dunklen Farben gestrichen und stehen im Kontrast zur schimmernden Leuchtdecke und der Eichenholzpflasterung. Der darunter liegende Saal für Wechselausstellungen ist ebenfalls frei einteilbar. Spiegelbildlich zur ersten Treppenanlage führt die zweite empor zum Schaulager und der alten Villa, deren Rundgang umkonzipiert wurde. Hier sind die Räume in neuen Farben gestrichen, das alte Haus wirkt im Gegensatz zum Neubau feingliedrig und privat.
Sicherheitstechnik
Für die gesamte Museumsanlage
entstand im Technikraum des ersten Untergeschosses der Villa
Wesendonck eine neue Elektro-Hauptverteilung mit allen Abgängen für
den Erweiterungsbau. Die Brandmeldeanlagen für den Vollschutz des
Erweiterungsbaus und des Ökonomiegebäudes wurden an die bestehende
Brandmeldezentrale der Villa angeschlossen. Die
beiden neuen Ausstellungsräume und der Eingangsbereich werden mit
einem Rauchansaugsystem (RAS) überwacht. Gasmelder
überwachen die Gasheizzentrale.
Da eine Erweiterung der bestehenden Wertschutzanlage nicht
möglich war, wurde für alle Häuser eine neue gemeinsame Zentrale
eingerichtet. Hier laufen alle Informationen zusammen - die
einheitliche Bedienung, Alarmierung und externe Übermittlung ist so
am ehesten gewährleistet. Die Wertschutz-Zentrale wertet die
Informationen der Melder und Sensoren aus, protokolliert Veränderungen
und löst entsprechende Alarme aus, die dann über eingebaute
Übermittlungsgeräte an die Polizei oder eine Wachgesellschaft
weitergeleitet werden. Eine Notstromversorgung ist integriert; das Gehäuse
ist mit einem elektronischen Bohrschutz ausgestattet. Die Anlage
kann vom PC aus oder über ein gesondertes Bedienteil gesteuert
werden, das wiederum durch die Eingabe von Codes, über Karten- oder
Fingerprintleser gesichert ist.
Die Ausstellungsräume und der Eingangsbereich sind überwacht durch
Bewegungsmelder und Funkbildermelder für den Raum- und Objektschutz, die Türen sind mit Magnet- und
Riegelkontakten gesichert. Ebenfalls durch Bewegungsmelder und
Magnetkontakte überwacht werden 50 Vitrinen im Kunstdepot.
Insgesamt 100 kabellose Bildermelder überwachen die beiden
Ausstellungsräume und das Depot. Solche Melder eignen sich zur
permanenten Überwachung beispielsweise von Gemälden,
Skulpturen oder auch Waffen und sind mit Klettband an den Objekten
befestigt. Ein integrierter Detektor meldet Vibrationen oder
Lageänderungen nach einstellbarer Empfindlichkeit, die Daten werden
auf einer speziellen Frequenz für Sicherheitsanwendungen
übertragen, die minimal störanfällig ist. Durch die drahtlose
Übermittlung des Alarms kann ein Exponat standortunabhängig
gesichert werden. Ein Bildermelder wird mit zwei handelsüblichen
1,5 V Alkali-Batterien betrieben, deren Zustand ständig überwacht
wird. Jeder Melder und jede Störung können einzeln identifiziert
und die Melder können gruppenweise oder einzeln abgeschaltet
werden. Alle Funksender, Module und Leitungen der Wertschutzanlage
sind auf Sabotage überwacht. Eine unterbrechungsfreie
Stromversorgungseinheit sichert die Funktion von Zentrale und
Empfängern auch bei Netzausfall.
Die vorhandene Telefonanlage wird durch DECT-Antennen erweitert,
damit das Personal in allen Gebäudeteilen über schnurlose Geräte
erreicht werden kann. Ein digitaler Alarmserver übermittelt die
Alarme in verschiedenen Notfällen auf die Telefonapparate.
Beide Eingangsbereiche - sowohl der Villa als auch der Erweiterung
- werden mit Videokameras überwacht, die Bilder werden
aufgezeichnet. Ein Monitor an der Kasse zeigt die Übersichten.
Im Falle eines Alarms schützt eine akustische Evakuationsanlage, an
die auch die Fluchtwegzonen der Villa Wesendonck angeschlossen
sind, den Erweiterungsbau. Sie dient der Übertragung von Durchsagen
und Anweisungen im Notfall, kann aber auch für Musik genutzt werden.
Eine Notlichtanlage im Technikraum des Kellergeschosses der Villa
Wesendonck versorgt die Notbeleuchtungen und Hinweisleuchten auf
den Fluchtwegen im Neubau. -us
Bautafel
Architekten: Arge Grazioli Krischanitz, Zürich (Adolf Krischanitz, Wien und Alfred Grazioli, Berlin)
Projektbeteiligte: W. Dietsche Baumanagement, Chur (Bauleitung); Ernst Basler + Partner, Zürich (Statik); Brunner Haustechnik, Wallisellen (HLKS-Ingenieur und Koordinator); Hege, Zürich (Elektroingenieur); Nox Systems, Vaduz (Wertschutzanlage); Helmut Federle, Wien (Kunst am Bau)
Bauherr: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Fertigstellung: Dezember 2006
Standort: Gablerstraße 14, 8002 Zürich
Bildnachweis: Willi Kracher, Zürich (1,2,4); Museum Rietberg, Zürich (3)