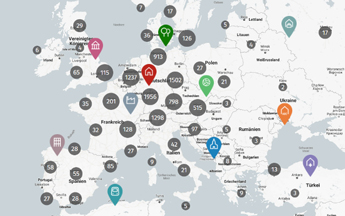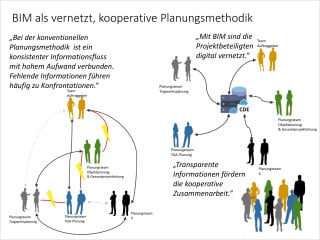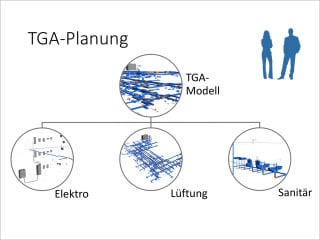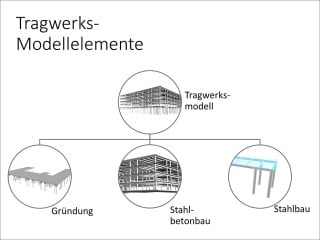Deichmanske Bibliotek in Oslo
BIM-Kooperation mit hohem Planungsnutzen
Das Gebiet des ehemaligen Containerhafens von Oslo wird seit gut
einem Jahrzehnt systematisch umgebaut. Die Entwicklung des Areals
im Stadtviertel Bjørvika bildet aktuell die größte städtebauliche
und architektonische Aufgabe in der norwegischen Hauptstadt. Nun
ist in direkter Nachbarschaft zur prägnanten Oper von Snøhetta mit
der neuen städtischen Hauptbibliothek Deichman Bjørvika ein
weiterer architektonischer Blickfang hinzugekommen. Entworfen wurde
der Neubau von Lund Hagem und Atelier Oslo. Auf 13.900
Quadratmetern Nutzfläche, die auf fünf Hauptgeschosse verteilt
sind, bietet das Gebäude Platz für mehr als 400.000 Bücher und
darüber hinaus lichte Leseplätze, ein Auditorium, einen Kinosaal
und gastronomische Versorgung.
Gallerie
Schon im Jahr 2006 wurde der Wettbewerb entschieden, aus dem die
zwei norwegischen Architekturbüros als Sieger hervorgingen. Die
Bibliothek, für die ein Zustrom von bis zu zwei Millionen Besucher
jährlich erwartet wird, sollte bereits 2016 eröffnet werden. Doch
Probleme mit drückendem Wasser und Lecks in der Konstruktion
verzögerten die Fertigstellung und erhöhten die Baukosten mit den
Jahren auf 2,5 Milliarden Norwegische Kronen (umgerechnet etwa 215
Millionen Euro).
Planungsänderungen mit großer Dynamik
Nach nunmehr
fast 15 Jahren vom Wettbewerb bis zur Fertigstellung hat das
Gebäude nichts von seiner entwurflichen und städtebaulichen
Qualität eingebüßt. Der große Zeitraum brachte jedoch eine andere
Schwierigkeit mit sich: Die Stadt Oslo forderte im Verlauf der
deutlich längeren Bauphase, die Planungen für das neue
Bibliotheksgebäude dahingehend zu überarbeiten, dass es
Passivhausstandard erreicht. So besteht die Fassade heute aus
transluzenten, wärmegedämmten GFK-Fassadenelementen, die
Wärmeverluste im Winter oder starke Wärmeeinträge im Sommer über
die Fassaden verhindern sollen. Zusätzlich wurden Fassadenelemente
mit dreischichtiger Isolierverglasung eingesetzt. Auch die
Gebäudetechnik ist zugunsten einer Energieeinsparung geplant: Durch
möglichst viele thermisch aktivierte Bauteile und Flächen wird das
Gebäude auf effiziente Weise klimatisiert und beheizt, sämtlich
Lüftungs-, Heiz- und Kühlleitungen verlaufen dabei im Boden. Im
Sommer erfolgt die Klimatisierung der Räumlichkeiten über das
Wasser des Oslofjords.
Zentraler Bibliotheksraum als Hauptmotiv des
Entwurfs
Auf die Forderung der Auslober, der Neubau solle
sich mit seiner Ausgestaltung gegenüber dem prägnanten Opernhaus im
Hafen zurücknehmen, antworteten die Architekten mit einer gläsernen
hülle, die je nach Tageszeit und Sonnenstand zwischen
unaufdringlicher Zurückhaltung und großer Eigenständigkeit im
heterogenen baulichen Umfeld variiert. Das Gebäude weist eine
horizontale Gliederung auf und teilt sich in fünf gestapelte
Scheibengeometrien auf. Die oberste Scheibe weitet sich zur einen
Seite hin fächerartig auf und markiert dadurch bereits von Weitem
den Eingang des öffentlichen Baus. Was von Außen als Auskragung
erkennbar wird, ist im Inneren eine große Rampe, die wie eine
Wendeltreppe die vierte und fünfte Etage verbindet.
Erschlossen wird die Bibliothek über drei zentrale Eingänge im Osten, Westen und Süden. Im Erdgeschoss wird der Außenraum ins Innere fortgesetzt; so werden die Besucherinnen und Besucher fließend ins Foyer geleitet. Diagonale Lichthöfe, die sich über alle Geschosse erstrecken, belichten die Eingangszonen zusätzlich. Entwurfsprägend für den Fünfgeschosser ist der durchgehende zentrale Bibliotheksraum. Die weiteren Bibliotheksräume befinden sich in den oberen Ebenen. Zusätzlich beinhaltet der Bau ein Auditorium, Werkstätten, Lesesäle, ein Kino, ein Restaurant, Büros und verschiedene Magazine.
Der Stahlbetonbaukörper sollte ursprünglich ein Stahldach erhalten, wurde jedoch im Zuge der tiefergehenden Bearbeitung und Planung ebenfalls in Beton ausgeführt und ist als gefaltete Betonkonstruktion eines der prägnantesten Elemente des Rohbaus. In die Dachkonstruktion wurde zudem die von außen sichtbare und über dem Hauteingang schwebende Rampe eingehängt. Die hohen Lasten der Auskragung werden komplett über die Massivdachkonstruktion abgeleitet, was ohne die pyramidenartige Faltung des Daches nicht möglich gewesen wäre. Die gefaltete Struktur ermöglicht es außerdem, den Innenraum der Bibliothek fast stützenfei zu gestalten – nur in den Tiefpunkten der Pyramiden wurden notwendigerweise Stützen eingesetzt.
Flexible Zusammenarbeit an individuellen
Planungsmodellen
Sowohl die 2D- als auch die 3D-Planung kam
bereits in der Vorentwurfsphase zum Einsatz. Hier wurde jedoch mit
nicht BIM-kompatiblen 3D-Modellen gearbeitet. Anders verhielt es
sich beim Tragwerksmodell: Die Tragwerksplaner entwickelten früh
ein parametrisches Modell, das ihnen umfassende
Optimierungsmöglichkeiten und Variantenprüfungen ermöglichte. Im
Laufe der weiteren Planung wurde dieses Modell in einer
BIM-Planungssoftware weiter ausgearbeitet. Hier entstand das
Geometrie- und Berechnungsmodell für die Statik. Mit dieser
Arbeitsweise war der bidirektionale Austausch von Änderungen am
Geometriemodell möglich. Auf diesem Modell basierend, entwickelten
die Tragwerksplaner letztlich die Tragstruktur. Das Ergebnis war
ein BIM-Tragwerksmodell, das neben der Geometrie unter anderem
umfassende Informationen zur Materialität, Bewehrung und den
Schalungsflächen enthielt.
Die Prüfung aller Fachplanungen und von deren Modelle erfolgte durch einen BIM-Koordinator. In interdisziplinären Workshops wurden alle Modelle abgeglichen und die Problempunkte und Kollisionen erörtert. Der für die Prüfung verwendete Model-Checker gab dafür ein Protokoll aus, in dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt waren. So hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, die Fehler zwischen zwei Projektbesprechungen abzuarbeiten und erneut prüfen zu lassen. Dabei arbeiteten die Gewerke jeweils in ihrem eigenen Fachmodell, ein Gesamtmodell gab es bei diesem Projekt nicht.
Umfassender Austausch via BCF
Im Zuge der weiteren Durcharbeitung waren beispielsweise
Tragwerksplanung und Haustechnik im engen Austausch miteinander.
Während der Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen gab es keine
weiteren Kollisionskontrollen der Modelle. Die Kommunikation von
Problempunkten, zum Beispiel bei der Durchbruchsplanung, erfolgte
über BCF, was den modellbasierten Austausch von Kommentaren und
Änderungsanforderungen erlaubt. Das Konstruktionsmodell bildete
darüber hinaus die Basis für eine massengestützte Kostenschätzung.
Mit fortschreitender Planungstiefe ließen sich die Kosten immer
weiter präzisieren, da das Modell nicht nur geometrische Daten,
sondern zusätzlich zahlreiche Bauteileigenschaften beinhaltete.
-tw
Bautafel
Architektur: Lund Hagem Arkitekter, Oslo; Atelier Oslo, Oslo
Projektbeteiligte: Skanska Norge, Oslo (Generalunternehmer); Scenario Interiørarkitekter MNIL, Oslo (Innenarchitektur), Bollinger + Grohmann Ingenieure, Frankfurt am Main und Oslo, Mutliconsult und BGKI, Oslo (Tragwerksplanung), Multiconsult, Oslo (Haustechnik)
Bauherrschaft: Oslo Kommune/Kultur- og Idrettsbygg, Oslo
Standort: Anne-Cath, Vestlys plass 1, 0150 Oslo, Norwegen
Fertigstellung: 2020
Bildnachweis: Bollinger und Grohmann Ingenieure, Frankfurt am Main; Jiri Havran, Oslo; Lund Hagem Arkitekter, Oslo; Jo Straube, Oslo; Erik Thallaug, Oslo
Fachwissen zum Thema
Baunetz Wissen Integrales Planen sponsored by:
Graphisoft Deutschland GmbH
Landaubogen 10
81373 München
Tel. +49 89 74643-0
https://graphisoft.com