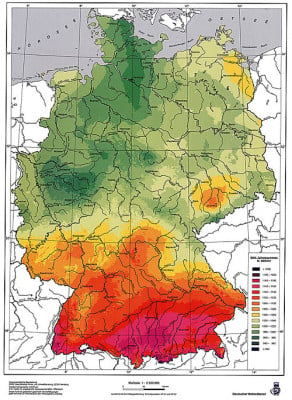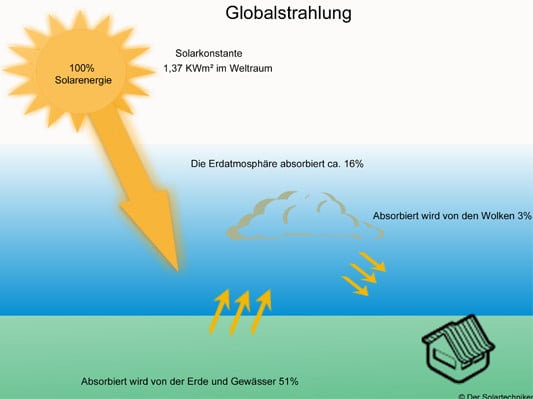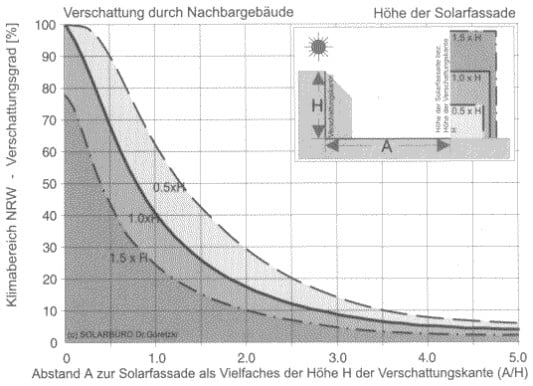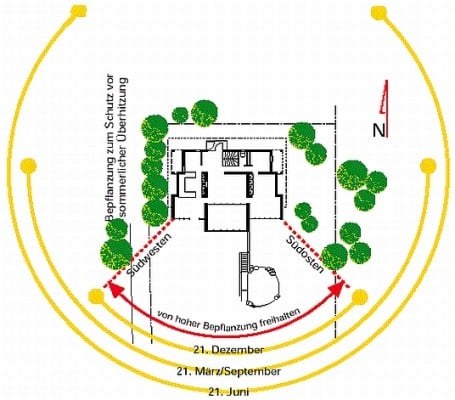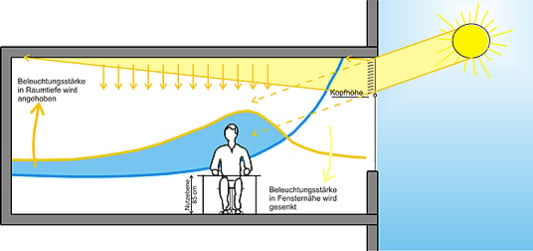Solartechnik in und am Gebäude
Gestaltungsgrundsätze und Planungsgrundlagen
Für die Nutzung der Solarenergie stellen die Dächer ein immenses Potenzial dar, deren Erscheinungsbild – Form, Neigung und Material – stark von regionalen Gegebenheiten bestimmt wird und nachhaltig die Gestalt von Städten und Dörfern prägt. Fassaden werden demgegenüber von einer Vielzahl zusätzlicher Aspekte charakterisiert. Als „Gesichter“ des Hauses zeigen sie in einem viel stärkeren Maße die Überlagerung von Gliederungen und Erscheinungsformen. Dies wird in Proportion und Einteilung, in architektonischen Schmuckformen sichtbar und spiegelt sich in Differenzierung, Übersteigerung und Modulation der Fassade und ihrer Teilbereiche. Des Weiteren sind auch Fragen der Oberflächenbeschaffenheit und der Farbigkeit mit einzuschließen. So stehen den Oberflächen solartechnischer Systeme – in der Regel glatte und spiegelnde Flächen aus Metall und Glas – meist Dachdeckungs- und Fassadenmaterialien mit rauen Strukturen und warmen Farbtönen gegenüber.
Gallerie
Häufig gelten nachträglich installierte Kollektoren und PV-Module als optisch störende Elemente auf dem Dach oder an der Fassade. Schon in den Anfangsjahren sah man das „Hauptübel“ in aufgeständerten Anlagen, also in additiven Maßnahmen. Aber auch heute sind immer noch Aussagen zu vernehmen wie „Die meisten Lösungen sind nicht wirklich integriert, sie sind einfach zum Gebäude hinzugefügt“. Hier hat über die Jahre ein großes Missverständnis überdauert, dass durch die Verknüpfung mit finanziellen Anreizen aus staatlichen Förderprogrammen noch verstärkt wurde. Das Unbehagen an den „aufgepflasterten“ Anlagen hat zunächst nichts mit der Art der baukonstruktiven Lösung zu tun. Maßgebliche Parameter einer gestalterisch stimmigen Lösung sind Modulabmessungen, Proportionen des Gesamtelements und dessen Binnengliederung, vor allem aber die gewählte Anordnung in der Fläche.
Gallerie
Eine Reihe gebauter Beispiele zeigt, dass Konzepte, die solartechnische Anlagen sowohl im Dach als auch in der Fassade additiv einsetzen, durchaus ein hohes Maß an architektonischer Qualität aufweisen. In diesen Projekten werden Kollektoren und PV-Module als weitere Funktionsebene begriffen, die – abgelöst von der wasserführenden Schicht – angeordnet sind. Dies kann seine Gründe im Bauablauf (Gewerketrennung) haben, aber auch in Nutzungsaspekten, etwa in der ausreichenden Hinterlüftung, geschützten Wartungsgängen etc. Wesentlich ist neben den baukonstruktiven und energetischen Aspekten die schlüssige Einbindung in ein übergeordnetes Gestaltungskonzept, das die räumliche Organisation, die formale Ausbildung des Gebäudes berücksichtigt; da ist die Frage nach additivem oder integriertem Einbau (zunächst) nachgeordnet zu betrachten.
Gallerie
Bei der gebäudeintegrierten Solartechnik sind in erster Linie Architekt*innen gefragt, unter Beteiligung von Fachplanenden, Herstellern und Handwerker*innen, Ingenieur*innen sowie Denkmalpfleger*innen. Architekt*innen sollten sich stärker mit der Zukunftsaufgabe, der Energieeffizienz im Bauen, auseinandersetzen. Gerade die notwendige energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes, einschließlich von Baudenkmälern und Ensemblestrukturen, erfordert eine sorgfältige Gestaltung. Aber nicht nur Architekt*innen müssen sich bewegen, sondern man wünschte sich bei den Herstellern eine größere Flexibilität, z.B. hinsichtlich einer moderaten Anpassungsoffenheit bei der Systemkonfiguration. Außerdem sind private und öffentliche Bauherren gehalten, als Auftraggeber auch gestalterisch überzeugende Lösungen von den Planenden einzufordern.
Eine Übersicht verschiedener Solarlösungen für Dächer und
Fassaden verschiedener Bauprodukte-Hersteller sind auf der
heinze.de Plattform aufgeführt (siehe Surftipps).